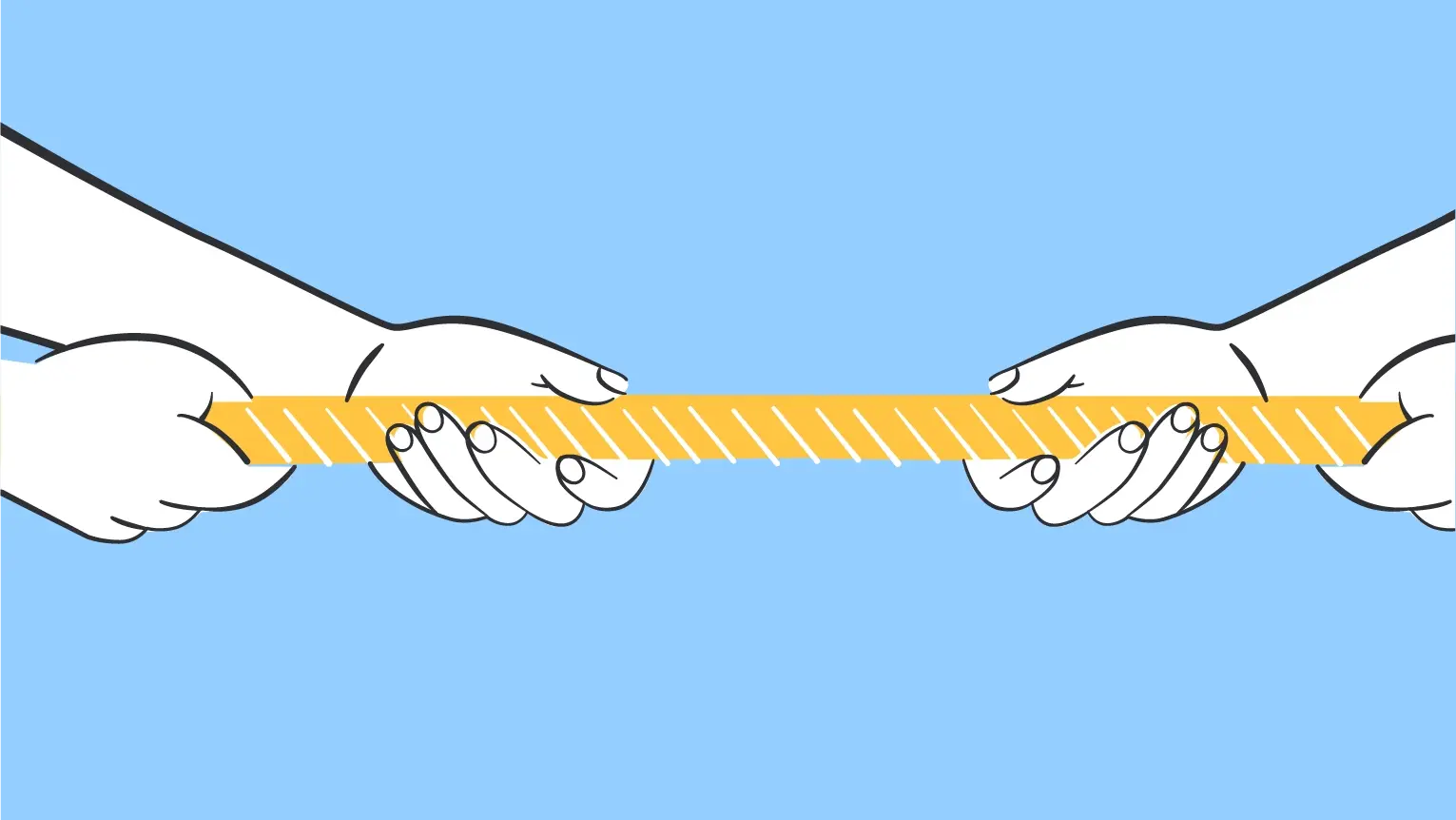
Gastkommentare : Ein Pro und Contra: Frist zur Regierungsbildung einführen?
Sollte mit einer Frist zur Regierungsbildung der Druck auf die Parteien erhöht werden? Hagen Strauß hält das für eine gute Idee, Stefan Reinecke nicht.
Pro
Weniger Spielchen

Wer A sagt, also eine Frist zur Regierungsbildung einführen will, sollte auch konsequent B sagen: Das wäre, die Amtszeit eines Kanzlers oder einer Kanzlerin auf zwei Legislaturperioden zu begrenzen bei gleichzeitiger Verlängerung der Wahlperiode von vier auf fünf Jahre. Ein Komplettpaket mit politischem Charme - allein schon, weil dann die asymmetrische Demobilisierung, die man zuletzt in diversen Wahlkämpfen erleben konnte, hoffentlich als Wahlkampfstil vom Tisch ist. Neue Personen, neue Themen, neuer Druck. Und vielleicht etwas mehr Leidenschaft.
In einigen Bundesländern gehen die Uhren schon anders, weil es Fristen für die Wahl des Regierungschefs und damit für die Regierungsbildung insgesamt gibt. In der Folge droht hier und da sogar die Auflösung des neu gewählten Landtags. Im Bund ist das nicht der Fall, weshalb 2017 quälend lange verhandelt werden konnte, bis das ganze Jamaika-Projekt dann doch implodierte. Anschließend folgte die gefühlt schier endlose Bildung der neuen GroKo, nicht minder aufreibend. Solche langwierigen Prozesse kann man nicht wollen, weil sie dem Wähler auch nicht zuzumuten sind.
Eine Frist befördert den Willen zur Einigung. Der zeitliche Korridor für taktische Spielchen verengt sich, nicht ernsthaft gemeinte Gespräche werden unwahrscheinlicher. Das ist gerade dann wichtig, wenn wie inzwischen drei oder vier Parteien miteinander verhandeln müssen und nicht mehr nur zwei. Die Erfahrung aus den Ländern lehrt zudem, dass Regierungen deshalb nicht instabiler sind. Im Gegenteil: Programmatisch wird sich aufs wirklich Wesentliche konzentriert und nicht aufs leidige Kleinklein, das Verhandlungen meist nur erschwert und in die Länge zieht. Also her mit der Frist.
Contra
Für Neues hinderlich

Wir stehen in Deutschland an der Schwelle vom Volksparteiensystem zu etwas Neuem. Unsere Parteienlandschaft ist im europäischen Vergleich zwar recht beständig. Aber das alte System mit SPD und Union als zentralen Playern, die eine Milieupartei zwecks Mehrheitsbeschaffung an sich binden, ist wohl Vergangenheit. Deshalb wird die Koalitionsbildung komplizierter.
Das war 2017, als Jamaika scheiterte, zu sehen; es ist derzeit bei der Ampel zu beobachten. Regierungsbildungen werden schwieriger, weil Konsensfindungen zu dritt umständlicher sind als zu zweit. Vor allem aber entstehen die Koalitionen selbst weit mehr als früher zufällig und ungeplant. Der FDP fehlte bis zum Wahltag die Phantasie, dass sie mit Rot-Grün ernsthaft über eine Koalition würde sprechen wollen. So ist es nun. Das ist neu im Bund. Es wird künftig öfter passieren.
Für Parteien werden Koalitionsgespräche damit zu fragilen Unternehmungen, in denen, weit mehr als in den alten Zweierbündnissen, der eigenen Klientel schwierige Kompromisse zugemutet und verkauft werden müssen. Die Kompromissbildungen, die früher in den Volksparteien selbst stattfanden, verlagern sich in die Koalitionsverhandlungen.
Diesen unerprobten, gewöhnungsbedürftigen Prozess sollte man nicht zeitlich begrenzen. Denn unter Zeitdruck kann die Basis der Koalition zu wenig belastbar ausfallen. Auch die Neigung, in unübersichtlicher Lage Neuwahlen anzupeilen, kann steigen. Beides wäre kein Vorteil.
Es gibt zudem kein Indiz, dass Parteien in Deutschland länger verhandeln als nötig. Sie erfinden gerade die neuen Routinen für die Postvolkspartei-Ära. Da wäre ein enges Zeitkorsett eher hinderlich.