Rassismus im Fußball : Von Helden und Buhmännern
Trotz der Erfolge migrantischer Spieler ist Rassismus noch immer ein Problem in den Fußballstadien. Die Gründe reichen bis in die Kolonialzeit zurück.

Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) im Zweikampf während des Endspiels der Champions League am 1. Juni dieses Jahres im Wembley-Stadion in London.
Einst wurden Bananen auf den Rasen geworfen oder auf den Tribünen Affenlaute imitiert, als die ersten dunkelhäutigen Spieler in den europäischen Ligen auftauchten. Diese Zeiten sind glücklicherweise weitgehend vorbei. Der Deutsche Fußballbund, Funktionäre von Spitzenklubs wie auch Ehrenamtliche in kleinen Amateurvereinen engagieren sich gegen Rassismus. Schwarze Kicker wie der Nationalspieler Antonio Rüdiger sind bei den Fans akzeptiert, sie werden in der Regel nach ihrer Leistung und nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt. Aber es ist auch noch nicht so lange her, dass der AfD-Bundestagsabgeordnete Alexander Gauland öffentlich verlauten ließ, einen Jerome Boateng wolle man lieber nicht zum Nachbarn haben - wofür er nicht nur von anderen Politikern, sondern immerhin auch in den Stadien heftigen Protest erntete.
Das britische Empire exportierte das Spiel nach Asien und Afrika
Pünktlich zur Europameisterschaft hat der Journalist Ronny Blaschke ein Buch über das koloniale Erbe des Fußballs vorgelegt. Die weltweite Verbreitung dieser massenwirksamsten Sportart, so die These des Autors, wäre ohne die globale Präsenz der europäischen Mächte nicht möglich gewesen. Vor allem das britische Empire exportierte das Spiel nach Asien und Afrika, Spanien und Portugal brachten es nach Mittel- und Südamerika - in ihrem eigenen Selbstverständnis als eine Art westlich-weißes Geschenk an rückständige Gesellschaften.
In Reportagen aus fünf Kontinenten schildert Blaschke die langfristigen Folgen, stets durch das Brennglas des Fußballs gesehen. Denn absurderweise hat gerade die Einwanderung aus den ehemaligen Kolonien dazu geführt, dass die europäischen Nationalteams durch die Integration dunkelhäutiger Kicker die Qualität ihrer Teams spürbar steigern konnten. Exemplarisch zeigte sich das zuerst in der französischen Nationalmannschaft, die wesentlich geprägt durch die Nachfahren algerischer Migranten wie Zinedine Zidane 1998 erstmals Fußball-Weltmeister wurde.
Krude Theorien über natürliche Veranlagungen
In England waren es vor allem Spieler aus der Karibik wie der in Jamaika geborene Raheem Sterling, hierzulande "Deutschtürken" wie Mesut Özil oder Ilkay Gündogan, die die Qualität der zuvor homogen weißen Teams verbesserten. Auch dadurch bestärkt entwickelte sich die Sportart Fußball zu dem heute etablierten milliardenschweren Business.
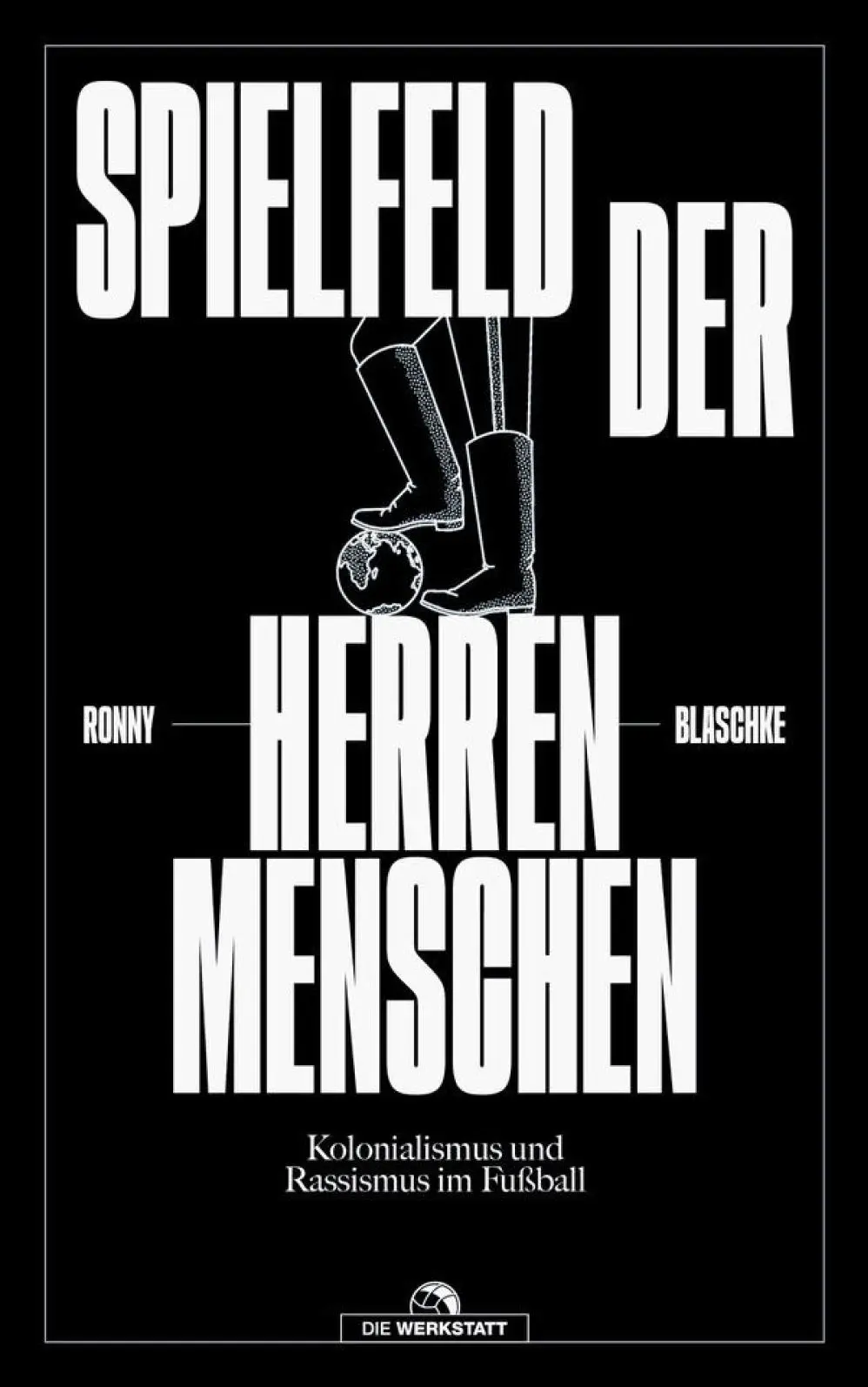
Ronny Blaschke:
Spielfeld der Herrenmenschen.
Kolonialismus und Rassismus im Fußball.
Die Werkstatt,
Bielefeld 2024;
256 Seiten, 22,00 €
Ein früher migrantischer "Held" war der portugiesische Fußballstar Eusebio, der aus dem damals noch als Kolonie besetzten Mosambik stammte. Er feierte mit Benfica Lissabon zahlreiche Meisterschaften und Erfolge in den europäischen Wettbewerben, seine Tore sicherten Portugal den dritten Platz bei der WM 1966. Zur gleichen Zeit glänzte für Brasilien der Spielmacher Pele, im größten Land Südamerikas waren Dunkelhäutige relativ früh in der Nationalmannschaft vertreten.
Typisch für die vorgebliche "Rassendemokratie" war dennoch die Behauptung, die schwarzen Straßenkicker hätten zwar eine natürliche Begabung für den Fußball, taugten aber nicht für sportliche Führungsaufgaben. Solche kruden Theorien hat die Wissenschaft längst widerlegt. Dazu gehört auch das Klischee, dass schwarze Spieler schneller laufen könnten und athletischer aufträten, dafür aber den Weißen in Sachen Taktik und Strategie unterlegen seien. Bis heute, so die These von Blaschke, durchziehe rassistisches Denken über natürliche Veranlagungen die Sportindustrie und ihr Umfeld. Und immer noch bedienen sich Fernsehkommentatoren gelegentlich entsprechender Stereotype, wenn sie das Verhalten schwarzer Spieler auf dem Platz beurteilen.
Keine Gnade bei sportlichem "Versagen"
Das Risiko, bei einem sportlichen "Versagen" ins mediale Trommelfeuer zu geraten, ist für Spieler mit Migrationshintergrund deutlich höher. Nach dem verlorenen Elfmeterschießen der englischen Nationalmannschaft im EM-Finale 2021 gegen Italien wurden in den britischen Boulevardmedien die dunkelhäutigen Jadon Sancho, Marcus Rushford und Bukayo Saka als Schuldige ausgemacht, weil sie ihren Strafstoß nicht verwandelt hatten. Der deutsche Mittelfeldregisseur Mesut Özil fiel nicht nur wegen mäßiger Leistungen bei der WM 2018 in Ungnade, sondern auch, weil er die Nationalhymne nicht mitsang und anlässlich der Präsidentenwahl in der Türkei den Autokraten Recep Erdogan unterstützt hatte.
In Blaschkes Buch geht es also um viel mehr als nur um Fußball, der "wohl einflussreichsten Alltagskultur unserer Zeit". Der Verfasser nutzt die Popularität der Sportart und den zeitlichen Aufhänger eines großen Turniers, um in kleinen Facetten und Anekdoten über die teilweise noch wenig bearbeitete europäische Kolonialgeschichte aufzuklären. Dieses Defizit gilt gerade für Deutschland, wo in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg aus gutem Grund die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Vordergrund stand, die zuvor begangenen Kolonialverbrechen der selbsternannten "Herrenmenschen" in Namibia oder Ostafrika aber lange verdrängt worden sind. Dem materialreichen Buch ist zu wünschen, dass es durch den eingängigen sportlichen Zugang eine größere Leserschaft erreicht als die zahlreicher werdenden, aber meist trockenen, wissenschaftlich orientierten Abhandlungen zum Thema.
