
Perspektiven auf die Sterbehilfe : Die letzten Fragen
Ihnen geht es um das gute Sterben - ein Sterbehelfer, eine Sterbebegleiterin aus der Hospizarbeit und ein Betroffener im Porträt.
Inhalt
Roger Kusch: Der Sterbehelfer hat die Schweiz als Vorbild
Roger Kusch ist der wohl bekannteste Sterbehilfe-Aktivist in Deutschland. Schon als Hamburger Justizsenator (2001 bis 2006) polarisierte der Ex-Christdemokrat mit einem Vorstoß zur Liberalisierung der aktiven Sterbehilfe. Nach Ende seiner politischen Karriere trat er 2008 dann mit einer Selbsttötungsmaschine an die Öffentlichkeit und verkündete weniger später, bei einem ersten Suizid assistiert zu haben. 2010 folgte die Gründung des Vereins Sterbehilfe, bei dem er heute als Präsident amtiert. Der inzwischen in der Schweiz sitzende Verein bietet seinen Mitgliedern Suizidassistenz an. Im vergangenen Jahr nahmen das 139 Mitglieder in Anspruch. Im ersten Halbjahr 2023 waren es laut Kusch 89. Aktuell zähle der Verein 3.400 Mitglieder.

Roger Kusch klagte in Karlsruhe.
Als Initialzündung, sich mit Sterbehilfe zu befassen, gibt Kusch ein Gespräch mit einem Freund an. Der habe ihm eindrücklich von dem spanischen Film "Das Meer in mir" (2004) erzählt, der von dem Sterbewunsch eines Querschnittsgelähmten handelt. Er habe sich dann intensiver mit der Rechtslage in Deutschland befasst und sei zu der verblüffenden Erkenntnis gelangt, dass die Rechtslage in Deutschland zu den liberalsten der Welt gehöre. "Man musste zum Sterben gar nicht in die Schweiz fahren."
Gegenwind von Seiten der Justiz
Doch die Aktivitäten Kuschs und des Vereins haben von Anfang an Gegenwind erfahren - von Seiten der Justiz etwa. Er habe den Überblick verloren, "wie oft die Polizei bei mir in der Wohnung war", berichtet der ehemalige Staatsanwalt. Alle strafrechtlichen Ermittlungen und Verfahren - sowohl gegen ihn als auch gegen Mitarbeiter des Vereins - hätten aber zu nichts geführt.
„Wer diese Prozedur auf sich nimmt, der hat darüber viel nachgedacht.“
Kräftiger politischer Gegenwind kam dann 2015 aus dem Bundestag. Das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe sei ausschließlich gegen seinen Verein gerichtet gewesen, so Kusch: "Es gab sonst niemanden, der das gemacht hat." Für den Verein sei das Verbot Ansporn gewesen, sich vor dem Verfassungsgericht zu wehren - mit Erfolg. Er habe zwar damit gerechnet, Recht zu bekommen, die klare Wortwahl des Gerichts habe ihn aber überrascht. "Sterbehilfe nicht nur zum Grundrecht des Sterbewilligen zu erklären, sondern die Sterbehelfer auch unter Grundrechtsschutz zu stellen, das war neu." Für Kusch geht es bei dem Thema vor allem um Selbstbestimmung: "Der Staat hat weder Legitimation noch Anlass, einen Menschen vor sich selbst zu schützen. Es sei denn, dass der Mensch nicht klar im Kopf ist."
Organisationen, die Suizidbegleitung in Deutschland anbieten, wurden nicht gefragt
Kusch ärgert, dass in den Diskussionen der vergangenen Monate und Jahre um eine Neuregelung im Bundestag die Perspektive der drei Organisationen, die inzwischen Suizidbegleitung in Deutschland anböten, nicht gefragt gewesen sei. So weist er beispielsweise das Argument, Sterbehilfe-Angebote würden Menschen unter Druck setzen, etwa um Angehörigen nicht zur Last zu fallen, entschieden zurück. "Das hat mit dem Alltag, den wir in unserer Praxis beobachten, überhaupt nichts zu tun. Suizid ist ein außerordentlich egozentrischer Akt". Mitglieder, die sich dazu entschieden, seien mit sich im Reinen. Das sei der Unterschied zu spontanen Suiziden, sagt Kusch und verweist auf das Verfahren des Vereins, bevor einem Mitglied das sogenannte "Grüne Licht" - die Zusage des Vereins, beim Suizid zu unterstützen - erteilt wird. "Wer diese Prozedur auf sich nimmt, der hat darüber viel nachgedacht."
Dass der Bundestag sich nun gegen eine Neuregelung entschieden hat, freut Kusch grundsätzlich. Die Diskussion werde damit aber nicht erledigt sein. Er und der Verein wollen sich weiter einsetzen für "gesellschaftspolitischen Respekt der Selbstbestimmung am Lebensende" - so wie in der Schweiz etwa. "Die Schweiz hat das Thema intellektuell und emotional im Griff", meint Kusch. "In Deutschland ist man weit davon entfernt."
Kerstin Kurzke: Die Begleiterin wünscht sich mehr "wir" beim Sterben
Wenn Kerstin Kurzke vom Tod spricht, schaut sie auf einen reichlichen Erfahrungsschatz zurück. "Das Leben ist ein Geschenk, alt werden ein Wunder", sagt sie am Telefon. Sterbebegleitung ist ihr Beruf. Für die Malteser leitet die 48-Jährige die Hospizarbeit- und Trauerbegleitung in Berlin. "Jedes Jahr kümmern wir uns um 400 bis 500 Menschen, die kurz vor dem Tod stehen."
Große Angst bekämen sie und ihre Kollegen häufig gespiegelt, vor allem vor dem, was kommt: Schmerzen, Luftnot, "das belastet die Patienten sehr, und da kommt schon mal der Wunsch auf, das Ganze zu vermeiden, eben abzukürzen". Im Schnitt 20 ihrer Patienten würden dies jährlich so formulieren, aber dann wieder davon abrücken. Denn, sagt Kurzke, machtlos sei man nicht.
Raum zum Äußern
Klar, der Endlichkeit kann sich niemand entziehen. Sie habe aber meist erlebt, dass die Leute schließlich Besseres finden würden als den Suizid. Was kann das sein, in einer Aussichtslosigkeit? "Zum einen machen wir den Patienten klar, dass wir die Angst total nachvollziehen. Und zum anderen geben wir ihnen einen Raum zum Äußern. Die Visualisierung der Angst hilft dann beim Umgang mit ihr. Oft verändert sich die Haltung." Im offenen Ansprechen ergäben sich oft neue Teillösungen, wie etwa die Hilfe eines Palliativarztes wegen der Schmerzen.
Kurzke sagt, sie habe einen Traumberuf. Mit 16 machte sie erste einschneidende Erfahrungen, als ihre Oma mit Krebs im Krankenhaus lag. Kurzke begleitete sie beim Sterben, es habe sich ergeben, "wir hatten ja ein gutes Verhältnis zueinander - sie erzählte mir von ihren Gedanken und Gefühlen; ich empfand Nähe, das war gut für sie und für mich". Mit 18 entschied sich Kurzke für Hospizarbeit, studierte Sozialpädagogik und ging dann mit 24 tatsächlich in die Hospizarbeit. Eine Patientin habe ihr neulich gesagt: "Eigentlich war ich immer tough und selbstständig. Jetzt merke ich, dass ich starke Freunde und Verwandte habe, ich muss nicht mehr so viel machen."
„Wir brauchen weiterhin Orte, an denen Suizidassistenz eben nicht angeboten wird.“
Kurzke wehrt sich gegen das Bild, dass Abhängigkeit weniger Wertigkeit zeitige. Sie wünscht sich für Deutschland auch beim Sterben mehr "wir", mehr Begleitung. "Wir sind allgemein mehr individuelle Autonomie gewohnt, aber das führt zu Überforderung in Lagen, in denen man nicht alles allein lösen kann".
Schieflage durch gesetzlich festgelegte Suizidbeihilfe
Vor allem solle der Gedanke an einen Suizid nicht von außen herangetragen werden - daher befürchtet sie durch eine gesetzlich festgelegte Suizidbeihilfe eine Schieflage. "Wir brauchen eine stärker geförderte Sterbebegleitung und weiterhin Orte, an denen Suizidassistenz eben nicht angeboten wird", sagt sie. Zwar sei in den vergangenen Jahren einiges neu erreicht worden, wie etwa die Einführung einer Vorsorgeplanung in Pflegeheimen. "Aber unsere Liste an Forderungen aus dem Jahr 2015 ist noch lang: Es bräuchte ein Palliativ-Team im Krankenhaus, eine finanziell geförderte niedrigschwellige Trauerbegleitung und natürlich viel mehr Pflegefachkräfte vor allem in den Pflegeheimen." Die Gesellschaft, meint Kurzke, benötige da noch "ein paar Schubse".
Ihre Arbeit empfindet sie als "sehr, sehr sinnvoll". Ihren Werdegang habe sie gefunden. Dies führe auch zur Frage, was wirklich wichtig im Leben sei. Und was ist das? Sie lächelt. "Die Beziehungen tragen einen, es ist das Zwischenmenschliche." Sich selbst bezeichnet Kurzke als emphatischen Menschen. Denkt sie an den eigenen Tod? "Klar, Sie nicht?" Sie hoffe, dass sie nicht plötzlich versterbe, dass "ich mich verabschieden kann".
Maximilian Schulz: Der Betroffene hat den Wunsch nach einer klaren Regelung
Die Schicksale von Mitpatienten, die er im Krankenhaus kennengelernt hat, haben Maximilian Schulz geprägt. Es waren zwei Männer, ein älterer Herr und ein junger Mann. Was sie einte: Sie befanden sich in ein einem Zustand der Zerrissenheit - sie waren am Leben, körperlich, aber wollten es nicht mehr sein. Selbst beenden konnten sie ihr Leben jedoch nicht.
Schulz sagt, er wolle die beiden Männer nicht zu seinen Kronzeugen machen. Doch er nutzt sie als Beispiele, um zu verdeutlichen, was er unter einem selbstbestimmten Tod versteht: Wird dieses selbstgewählte Ende verwehrt, wird den Menschen auch ihre Würde verwehrt. Selbstbestimmtheit und Würde, das sind die beiden Punkte, mit denen der Student für ein liberales Sterbehilfegesetz plädiert.
"Man kann den Freitod nicht verbieten. Aber man kann ihn selbstbestimmt, würdevoll und vor allem schmerz- und angstfrei gestalten." So formulierte es der 36-Jährige vergangenen November in der Anhörung des Rechtsausschusses.
Aufenthalte im Krankenhaus: Für Schulz Alltag
Der Wunsch nach einem Ausweg - Schulz weiß, wovon er spricht. Seit seinem sechsten Lebensjahr ist er wegen einer chronischen Erkrankung regelmäßig in Behandlung, Krankenhausaufenthalte gehören fast zum Alltag. Doch im Jahr 2016 verändert eine Operation sein Leben massiv: Nach einem medizinischen Unfall wacht Schulz nach der OP auf und kann seine Beine nicht mehr bewegen; er ist fortan querschnittsgelähmt.
Er hadert mit diesem Schicksalsschlag, ist verzweifelt, will nicht mehr leben. Seine Mutter, so erzählt Schulz, hilft ihm nach langen und intensiven Gesprächen, der deutschen Dependance des schweizerischen Sterbehilfevereins Dignitas beizutreten. Der junge Mann will in der Lage sein, selbst zu entscheiden, unter welchen Bedingungen er weiterlebt - oder eben nicht. Er habe sich damals im Krankenhaus mit dem Gedanken getragen, zu sterben, sagt Schulz ganz offen. Generell spricht er sehr deutlich, findet, dass das Thema Tod, Suizid und auch mentale Gesundheit und ihre Folgen immer noch zu sehr tabuisiert werden.
Schnell kann alles anders sein
Nach vielen Wochen kämpft sich der junge Mann nach dem OP-Unfall damals zurück ins Leben. In den Medien, vor den Abgeordneten und im persönlichen Gespräch beschreibt er, wie viel Freude er heute am Leben habe, und dass er jetzt hofft, in hohem Alter einfach einschlafen zu können.
„Die ideale Sterbehilfe bedeutet für mich Lebensqualität.“
"Aber die Erfahrung aus dem Jahr 2016 hat mir gezeigt, wie schnell sich das Leben ändern kann", sagt Schulz. Für diesen Fall möchte er vorbereitet sein und die Möglichkeit, selbstbestimmt sein Leben zu beenden, gesetzlich geregelt wissen. "Die ideale Sterbehilfe bedeutet für mich Lebensqualität", sagte Schulz im Bundestag. "Sie schenkt mir Zeit, die ich nicht darauf verwenden muss, die Art und den Zeitpunkt eines würdigen Todes entweder strafrechtlich abzustimmen oder von meiner medizinischen Notlage abhängig zu machen."
Dabei betont Schulz, dass eine liberale Sterbehilferegelung nicht dazu führen dürfe, dass an der Suizidprävention oder der Unterstützung von Menschen in psychischen Notlagen gespart wird: Es müsse sichergestellt werden, dass jeder Sterbewillige hinlänglich und erschöpfend über jede Form der therapeutischen oder medizinischen Alternativen informiert ist und nur auf eigenen Wunsch, nicht aufgrund materieller Mängel ihm die Zugänge zu diesen verwehrt werden.

Zwei Gruppen von Abgeordneten wollten die Suizidhilfe neu regeln. Doch ihre Gesetzentwürfe fanden im Bundestag keine Mehrheit.
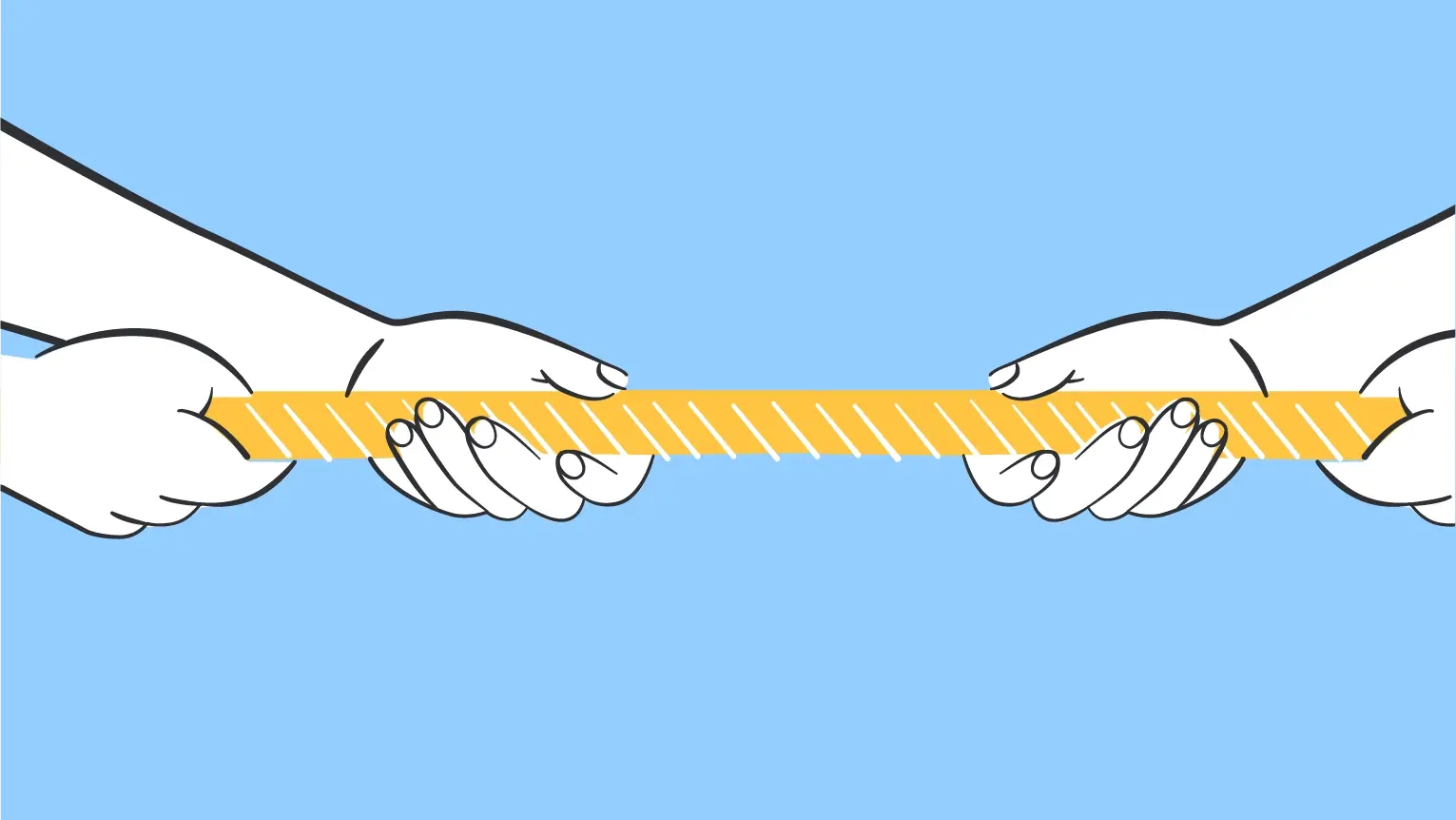
Das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe wurde gekippt. Rainer Woratschka und Kerstin Münstermann im Pro und Contra, wie der Staat mit dem heiklen Thema umgehen soll.

Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, Ute Lewitzka, fordert ein Gesetz zur Suizidprävention.
Dass sich keiner der Gesetzentwürfe durchgesetzt habe, sei ein Stück weit frustrierend, sagt Schulz nach der Abstimmung. "Ich hoffe aber, dass die Debatte nun endlich umfassend geführt wird, so wie es viele im Parlament jetzt wieder verlangt haben. Aber die Debatte muss dann auch zu einem Ergebnis führen und sollte nicht ohne Regelung versanden."

