Faustische Forschung : Geheime Entwicklung einer neuen Wunderwaffe
In "Atom" inszeniert Steffen Kopetzky die Jagd auf den Leiter des Geheimwaffenprogramms der Nazis in der literarischen Grauzone zwischen Wirklichkeit und Fiktion.
Deutschland stand im Frühjahr 1945 vor einer beispiellosen militärischen und moralischen Katastrophe. Dennoch bedeutete die bedingungslose Kapitulation am 8./9. Mai keine "Stunde Null". Im Gegenteil: Die Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands und die Konferenz der Alliierten in Potsdam verbanden den Zweiten Weltkrieg samt seiner Vorgeschichte mit dem Kalten Krieg, der erst 1990/91 mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Zerfall der Sowjetunion endete.
Aus dieser erweiterten historischen Perspektive führt Steffen Kopetzky durch die letzten Wochen des Kriegs in Europa, bevor im August 1945 mit dem Abwurf zweier amerikanischer Atombomben über Japan der Weltkrieg einen grauenhaften Abschluss fand.
Der Spionageroman orientiert sich an angelsächsischen Vorbildern
Kopetzkys "Atom" ist ein Spionageroman und der Autor orientiert sich stilistisch an einschlägigen angelsächsischen Vorbildern; denn seine Hauptfigur ist nicht nur Physiker, sondern Agent des britischen Auslandsnachrichtendienstes MI 6. "Scientia potentia est - Wissen ist Macht!" Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gehörte die Maxime des englischen Philosophen und Staatsmanns Francis Bacon zu den Triebfedern wissenschaftlicher Arbeit in Deutschland.
Das galt vor allem für den geradezu faustischen Forschungsdrang in der Nuklearphysik. Die Zahl und die Namen deutscher Nobelpreisträger jener Zeit sprechen für sich selbst. Am Ende waren es die Ergebnisse ihrer Forschung, die die verzweifelte Hoffnung auf "Wunderwaffen", die Durchhalteparolen der Nazis und die Furcht ihrer Gegner nährten.

Kopetzkys fiktive Jagd nach dem Leiter des deutschen Geheimwaffenprogramms führt die Leser durch die letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges.
Folgerichtig beginnt Kopetzkys Roman im Berliner akademischen Milieu der späten Weimarer Republik. Damals versuchten im Umfeld der Friedrich-Wilhelms-Universität junge Physiker verschiedener Länder im Auftrag ihrer Regierungen das strategische Wissenschaftspotenzial des Deutschen Reichs aufzuklären. Die Odyssee des Helden führt vom friedlichen Wannsee durch das düstere London der ersten Kriegsjahre in die Spionagenetzwerke Lissabons. Schließlich endet sie dramatisch im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren, dem heutigen Tschechien. Nach ihrer Besetzung im März 1939 war die ehemalige Waffenschmiede der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie zu einem der wichtigsten deutschen Rüstungszentren geworden.
In den Skoda-Werken und ihren Zulieferbetrieben herrschte ein skrupelloser Ingenieur: Hans Kammler, SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. Er war verantwortlich für die Herstellung jener "Wunderwaffen", die an besonders gesicherten Standorten, etwa dem thüringischen Nordhausen, unter schwersten Menschenrechtsverletzungen bis in die letzten Kriegstage produziert wurden. Hat Kammler am 9. Mai 1945 in der Nähe von Prag Selbstmord begangen? Oder hat er, wofür viel spricht, mit seinem Wissen und seiner Erfahrung bei einer Siegermacht Zuflucht gefunden?
Selbst James Bond-Erfinder Ian Fleming wird bei Kopetzky zur Romanfigur
Steffen Kopetzky gilt nicht ohne Grund als Meister des sorgfältig recherchierten historischen Romans. Vor dem Hintergrund tatsächlichen Geschehens beschreibt er atemberaubend die fiktive Jagd nach dem Cheforganisator des deutschen Geheimwaffenprogramms. Souverän spielt er mit literarischen Vorbildern und macht selbst Ian Fleming, den Erfinder von James Bond, zur Romanfigur.
Wie Thomas Pynchon, der legendäre Autor der amerikanischen Postmoderne, bewegt sich Kopetzky permanent in der literarischen Grauzone zwischen Wirklichkeit und Vorstellung. Es geht ihm nicht nur um die spannende Agentengeschichte, sondern auch um die Motive und Gewissensentscheidungen seiner Protagonisten und ihrer Auftraggeber. Führten sie den Kampf gegen Nazi-Deutschland aus moralischen Erwägungen? Oder war für sie der Krieg gegen Hitler nur Teil eines weltumspannenden Kampfes um die Weltherrschaft, in dem aus geostrategischem Kalkül der Gegner von heute bereits als hilfreicher Partner von morgen betrachtet wurde?
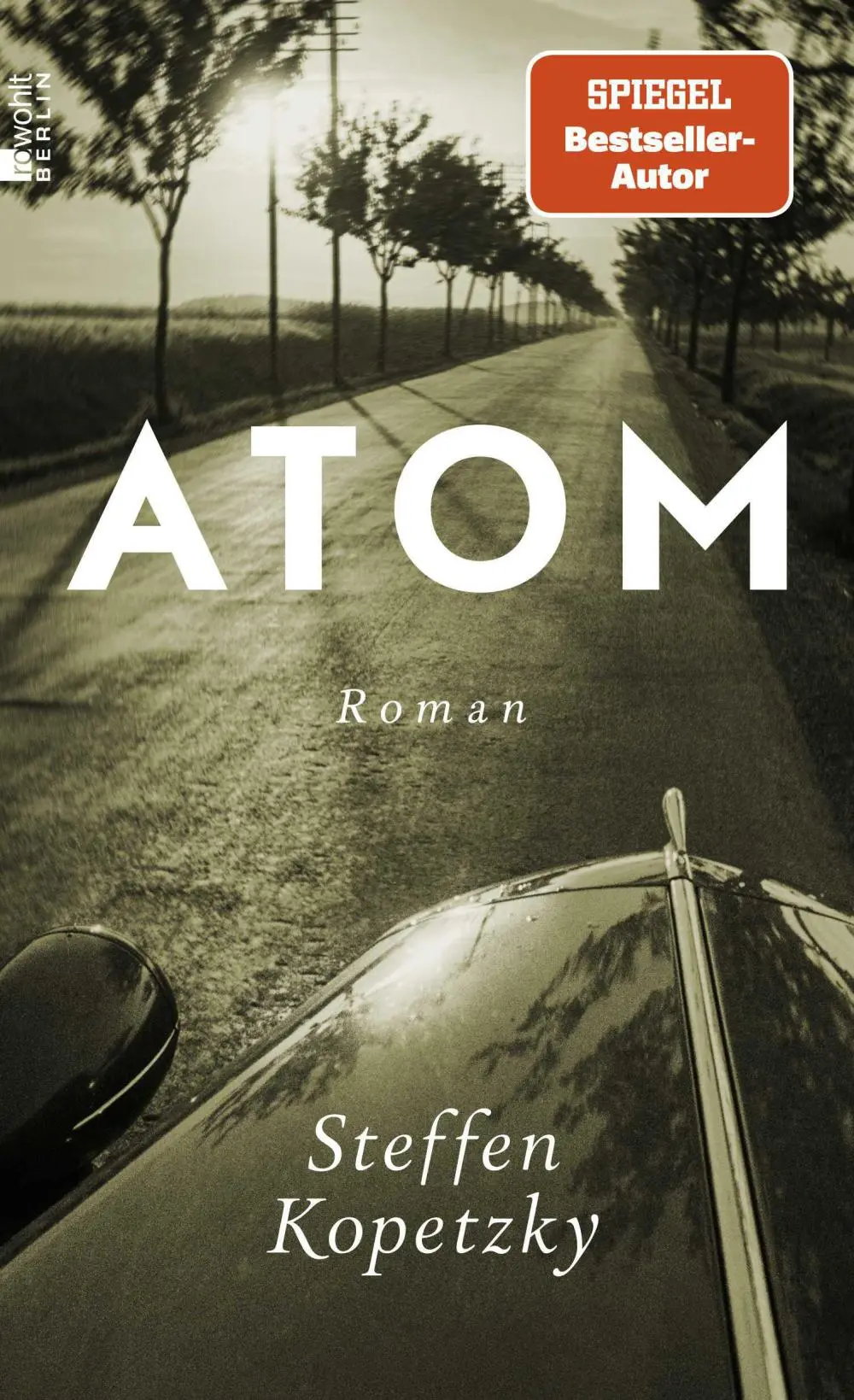
Steffen Kopetzky:
Atom.
Rowohlt Berlin,
Berlin 2025;
412 S., 26,00 €
Kopetzky neigt zur realistischen Betrachtungsweise. Danach werden die entscheidenden Interessen und Ziele der Politik nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, sondern als Staatsgeheimnisse im kleinsten Kreis erörtert und gehütet. Geheimdienste glauben nicht an Verschwörungstheorien, sondern sie handeln als Verschwörer. Unter strenger Geheimhaltung implementieren sie strategische Langzeitprogramme in verdeckten Operationen, deren Wirkungen sich schließlich unabhängig und unbemerkt von zivilgesellschaftlichen Diskursen, internationalen Konferenzen oder parlamentarischen Legislaturperioden entfalten.
Ausblick auf das Wettrüsten der Siegermächte in den 1950er Jahren
Mit einem kurzen Epilog leitet Kopetzky über in die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Zumindest in Umrissen wurde damals erkennbar, welche Beiträge die deutsche Forschung und die Geheimprogramme des "Dritten Reichs" für das Wettrüsten und die atomaren Vernichtungspotentiale der Siegermächte geleistet hatten.
Steffen Kopetzkys überraschender Schluss lässt hoffen, dass er die Erzählung fortschreiben wird. In "Monschau", seinem in der späten Adenauer-Zeit spielenden Erfolgsroman, schilderte er bereits einen wichtigen Abschnitt westdeutscher Geschichte mit verblüffenden Bezügen zum neuen Roman.
Auch Lesenswert

Der Historiker Richard Overy erklärt den Zweiten Weltkrieg als eine imperiale und globale Konfrontation, die deutlich vor 1939 beginnt und erst nach 1945 endet.

Die Journalistin Franziska Augstein porträtiert die Jahrhundertgestalt Winston Churchill in einem mitreißend geschriebenen Buch als Arbeitstier - und Genießer.

Der Historiker Raffael Scheck zeichnet anhand persönlicher Zeugnisse nach, wie die Menschen im Frühjahr 1940 den erneuten Krieg in Westeuropa erlebten.