Im Dienst der Medizin : Als Arzt in der Antarktis
Der Chirurg Tim Heitland lebt und forscht seit Jahren in der Antarktis. Als Arzt der Neumayer-Station III betreute er Wissenschaftler unter extremen Bedingungen.
An intensive Farben denken wohl die wenigsten, wenn sie sich die Antarktis vorstellen - eher an eine monochrome Landschaft aus Schnee und Eis, das blendende Weiß der Flächen, das kalte Blau der Eisberge und das trübe Grau der Schneestürme. Doch Tim Heitland sieht mehr. Für ihn ist der entlegene Kontinent eine riesige Leinwand, auf der die Natur ihre Bilder malt - in feuerroten Sonnenuntergängen, in tanzenden grünen und roten Polarlichtern und in einer Milchstraße, die sich majestätisch über den Horizont spannt. Und Heitland muss es wissen: Der 49-jährige Arzt hat bereits mehrere Expeditionen in die Antarktis unternommen, mittlerweile fast zwei Jahre dort verbracht und die Region in all ihren Facetten kennengelernt.
Neumayer-Station III: Forschung unter extremen Bedingungen
Noch vor zehn Jahren war Heitland als Oberarzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie in München tätig. Schichtdienste, anspruchsvolle Operationen und der Takt des Krankenhauses waren sein Alltag. Doch er suchte eine neue Herausforderung: "Ich bin schon immer gern gereist und suchte einen Kontrast zum Klinikleben", sagt er. 2016 wagt der Arzt dann den Schritt ins Unbekannte: als Stationsleiter und Arzt der Neumayer-Station III, der modernsten deutschen Forschungsstation in der Antarktis. Vierzehn Monate bleibt er dort, acht davon abgeschottet von der Außenwelt - ohne den Besuch eines einzigen Schiffes oder Flugzeugs. Nur die Station und elf weitere Expeditionsmitglieder.
Seit 1981 betreibt Deutschland eine Überwinterungsstation in der Antarktis. Die heutige, hochmoderne Neumayer-Station III wurde 2009 errichtet und steht unter der Leitung des Alfred-Wegener-Instituts. Dort sammeln Wissenschaftler langfristige Klimadaten, erforschen Umweltveränderungen - und, in Heitlands Fall, auch den Menschen selbst. Denn die extreme Isolation des Kontinents macht ihn zu einem idealen Modell für die Forschung in der Raumfahrtmedizin. Wie verändert sich der Mensch, wenn er monatelang von der Außenwelt abgeschnitten ist? Welche Spuren hinterlassen Kälte und Dunkelheit- physisch wie psychisch?
Die Bedingungen rund um die Station sind extrem: Im Polarwinter können die Temperaturen auf bis zu minus 50 Grad Celsius sinken, während Stürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde über das Eis fegen. Acht Wochen lang, während der Polarnacht, herrscht völlige Dunkelheit , nur die Sterne und das Leuchten der Polarlichter durchbrechen die Finsternis als natürliche Lichtquelle.
So meistern Wissenschaftler das Leben in der Antarktis
Wenn der antarktische Sommer beginnt, erwacht das Leben auf der Neumayer-Station. Dann sind nicht mehr nur die Überwinterer dort. Bis zu fünfzig Wissenschaftler reisen an, die auf der Station forschen, leben - und medizinisch betreut werden müssen. Für den Stationsarzt bedeutet das: Er ist allein verantwortlich, ganz gleich, ob es um Infekte geht oder um ernste Notfälle. Heitland war sich dieser Verantwortung bewusst und bereitete sich entsprechend vor. Der erfahrene Chirurg drückte noch einmal die Schulbank, absolvierte unter anderem einen dreiwöchigen Intensivkurs in Zahnmedizin. "Ich muss dort alles können", sagt er nüchtern. “Schließlich kann ich in der Antarktis niemanden überweisen.”
Sind dennoch kompliziertere Eingriffe nötig, ist der Arzt am Ende der Welt aber nicht ganz auf sich allein gestellt. Über eine Videoverbindung steht ihm ein Netzwerk aus Spezialisten zur Seite - Fachärzte des Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide können ihn per Telemedizin beraten, schauen mit auf Röntgenbilder, wägen gemeinsam ab und geben Anleitung, wenn nötig. Doch all das ist nur der Plan B. Damit es gar nicht erst so weit kommt, werden die Expeditionsteilnehmer vor der Abreise gründlich durchgecheckt - wortwörtlich auf Herz und Nieren überprüft.
„In der Antarktis wird die letzte Karotte zelebriert.“
Doch nicht nur medizinisch ist eine gründliche Vorbereitung nötig, auch als Team müssen die Überwinterer funktionieren. Noch vor dem Abflug lebt das neunköpfige Kernteam vier Monate in Deutschland zusammen. In dieser Zeit trainieren sie Notfallszenarien, üben Rettungstechniken in Gletscherspalten oder proben, wie Brände auf der Station gelöscht werden. "Überwintern ist Teamsport", sagt Heitland. Denn in der Isolation der Antarktis reicht Fachwissen allein nicht aus - entscheidend sei, dass man sich aufeinander verlassen kann.
Rückkehr in die Heimat nach 14 Monaten in der Abgeschiedenheit
Nach 14 Monaten in der Abgeschiedenheit der Neumayer-Station sei die Rückkehr nach Deutschland nicht ganz einfach, sagt Heitland - Menschenmengen, Straßenlärm, Reizüberflutung. "Aber natürlich freut man sich auf Freunde, Familie - und besonders auf Kirschtomaten." Zwar bringt der Forschungseisbrecher Polarstern einmal im Jahr rund 60 Tonnen Vorräte, doch frische Lebensmittel sind schnell aufgebraucht. "In der Antarktis wird die letzte Karotte zelebriert", berichtet Heitland und lacht. Stören tut ihn das nicht. Schon im November geht es wieder los, die nächste Expedition steht an. Die Antarktis, sagt er, lässt ihn nicht mehr los.
Mehr zur Antarktis

Mit 120.000 Besuchern pro Saison ist die Antarktis im Massentourismus angekommen. Eine große Herausforderung für Flora und Fauna vor Ort.
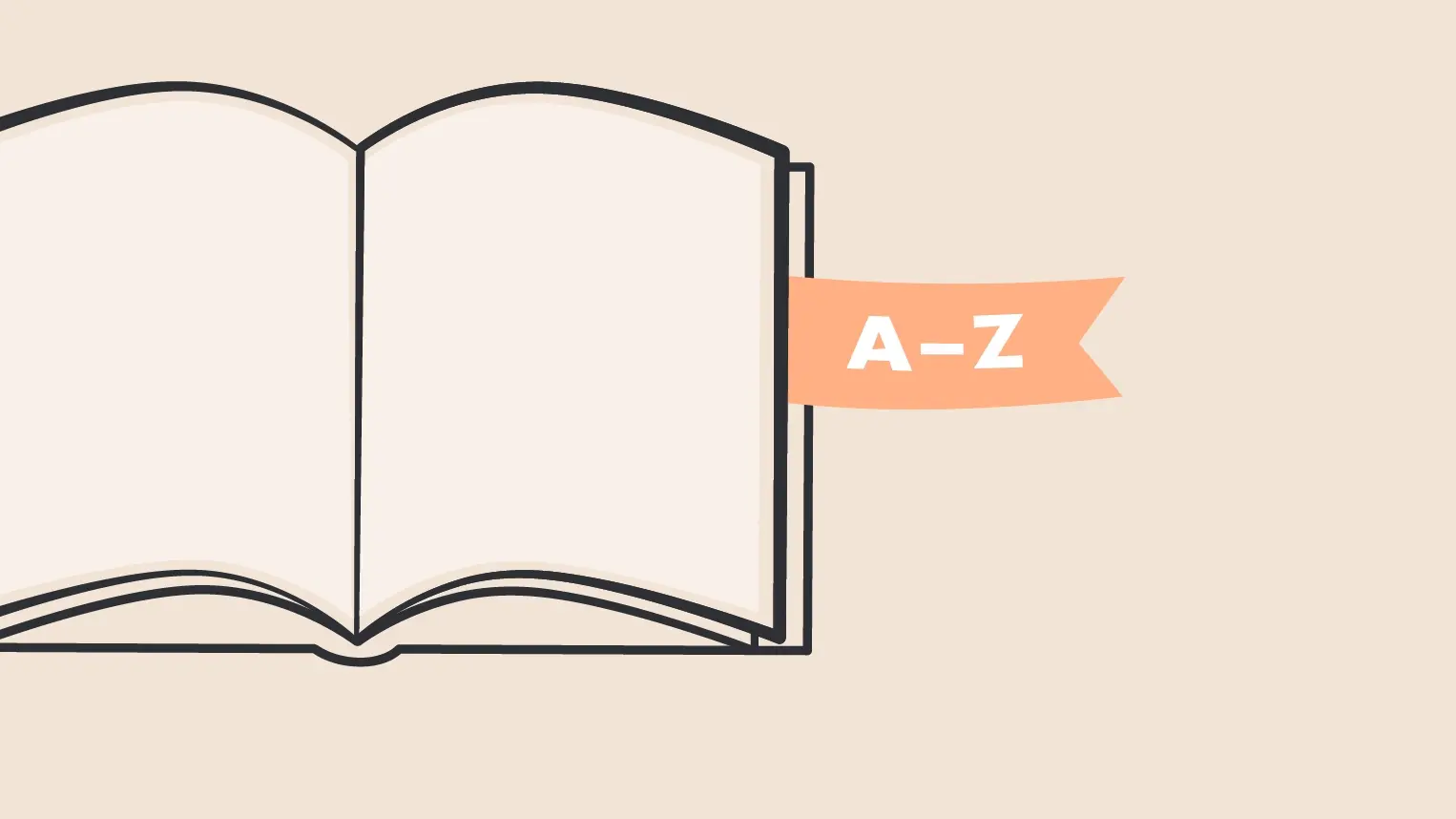
Wem gehören Nord- und Südpol? Und wer schützt dort die Umwelt? Die wichtigsten Abkommen und Gremien der Polarregionen auf einen Blick.

Die Meere der Antarktis und ihre Artenvielfalt sollen nachhaltig geschützt werden, aber Russland und China sind an den Fisch- und Krillbeständen interessiert.




