
Globales Bevölkerungswachstum : Der exponentielle Trend ist gestoppt
In „Das Bevölkerungsargument“ beschreibt Dana Schmalz wie die Angst für Überbevölkerung politisch genutzt wird – und gibt für die Zukunft Entwarnung.
Spätestens zu Beginn des 22. Jahrhunderts, sagen neuere Extrapolationen voraus, dürfte die Zahl der Erdbewohner sinken. Die Versorgung von dann rund zehn Milliarden Menschen mit Nahrungsmitteln ist durch Fortschritte in der Landwirtschaft gut gesichert.
Trotz starker Ungleichgewichte und Katastrophen vor allem im subsaharischen Afrika haben sich frühere "Hungerprognosen" als weitgehend falsch herausgestellt. So besehen gibt es gute Gründe für die entspannte Betrachtung eines Themas, das aber vor allem in den 1960er und 1970er Jahren als bedrohliches Szenario diskutiert wurde.
Wie Angst vor Überbevölkerung die Politik beeinflusst
Dana Schmalz, Referentin am Heidelberger Max-Planck-Institut für ausländisches Recht und Völkerrecht, analysiert, wie "die Sorge vor zu vielen Menschen Politik beeinflusst". Ihr zufolge nutzen manche Regierungen bis heute das "Bevölkerungsargument", so der etwas umständliche Buchtitel, um zum Beispiel die reproduktiven Rechte von Frauen einzuschränken.
Auch rechtspopulistische Kreise verweisen häufig auf angeblich zu hohe Geburtenraten anderswo. Soziale und verteilungspolitische Probleme werden auf ein übermäßiges Bevölkerungswachstum in entfernten Weltregionen zurückgeführt, das reicht bis zur rassistischen Verschwörungstheorie vom "großen Austausch". Die "Verdächtigung der Unerwünschten", so eine Kernthese der Autorin, bilde den latenten Hintergrund vieler Kontroversen um das Thema Migration.
In Europa gab es ab 1800 ein rapides Bevölkerungswachstum
Alarmismus in demografischen Prognosen ist nichts Neues. Schon 1798 schrieb Thomas Malthus seinen berühmten "Essay on the principle of population". Der britische Pfarrer und spätere Professor für Ökonomie machte pauschalisierend "die Armen" für das Bevölkerungswachstum verantwortlich, diese hätten einfach zu viele Kinder. Das Privatleben der Menschen moralisch zu bewerten und zu verurteilen wurde im 19. Jahrhundert zu einem weit verbreiteten Deutungsmuster - und der Prediger Malthus damit zu einer zentralen Figur der sich etablierenden Wissenschaft von der Demografie.
Die diesen Diskurs prägende "Unruhe", wie Dana Schmalz es nennt, hatte handfeste Ursachen. Bessere Lebensbedingungen durch die Industrialisierung sowie der medizinische Fortschritt bewirkten ein rapides Sinken der Kindersterblichkeit. Die Bevölkerung weltweit, die im Mittelalter und auch noch zu Beginn der Neuzeit relativ konstant geblieben war und zudem immer wieder durch Seuchen wie die Pest dezimiert wurde, wuchs ab ungefähr 1800 rasant - anfangs vor allem im vergleichsweise reichen Europa der Kolonialmächte.
„Nicht nur das Wachstum der Weltbevölkerung insgesamt, sondern besonders die regionalen Verschiebungen machten Bevölkerungsfragen zu einem so intensiv diskutierten Thema.“
Schmalz liefert dazu anschauliche Statistiken: In England und Wales stieg die Zahl der Einwohner im Laufe des 19. Jahrhunderts von knapp neun auf 32 Millionen. Deutschlands Bevölkerung nahm im selben Zeitraum von 18 auf 55 Millionen zu. Diese Beispiele sind umso bemerkenswerter, weil allein von 1850 bis 1913 rund 40 Millionen Europäer nach Amerika emigrierten.
Die ersten Einwanderungsgesetze zur rassistischen Steuerung der Migration erließen nicht zufällig die Siedlerkolonien in Nordamerika und Australien. Willkommen waren dort vorrangig nordische Nationen wie Briten, Deutsche oder Skandinavier. Italiener, Osteuropäer und erst recht Asiaten und Afrikaner - wenn sie nicht zuvor als Sklaven verschleppt worden waren - sollten draußen bleiben.
Afrika ist mittlerweile der am schnellsten wachsende Erdteil
"Nicht nur das Wachstum der Weltbevölkerung insgesamt, sondern besonders die regionalen Verschiebungen machten Bevölkerungsfragen zu einem so intensiv diskutierten Thema", resümiert Schmalz. Das gilt erst recht für die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, die durch niedrige Fertilitätsraten in den meisten westlichen Staaten, aber weiterhin hohe Kinderzahlen im globalen Süden gekennzeichnet ist.
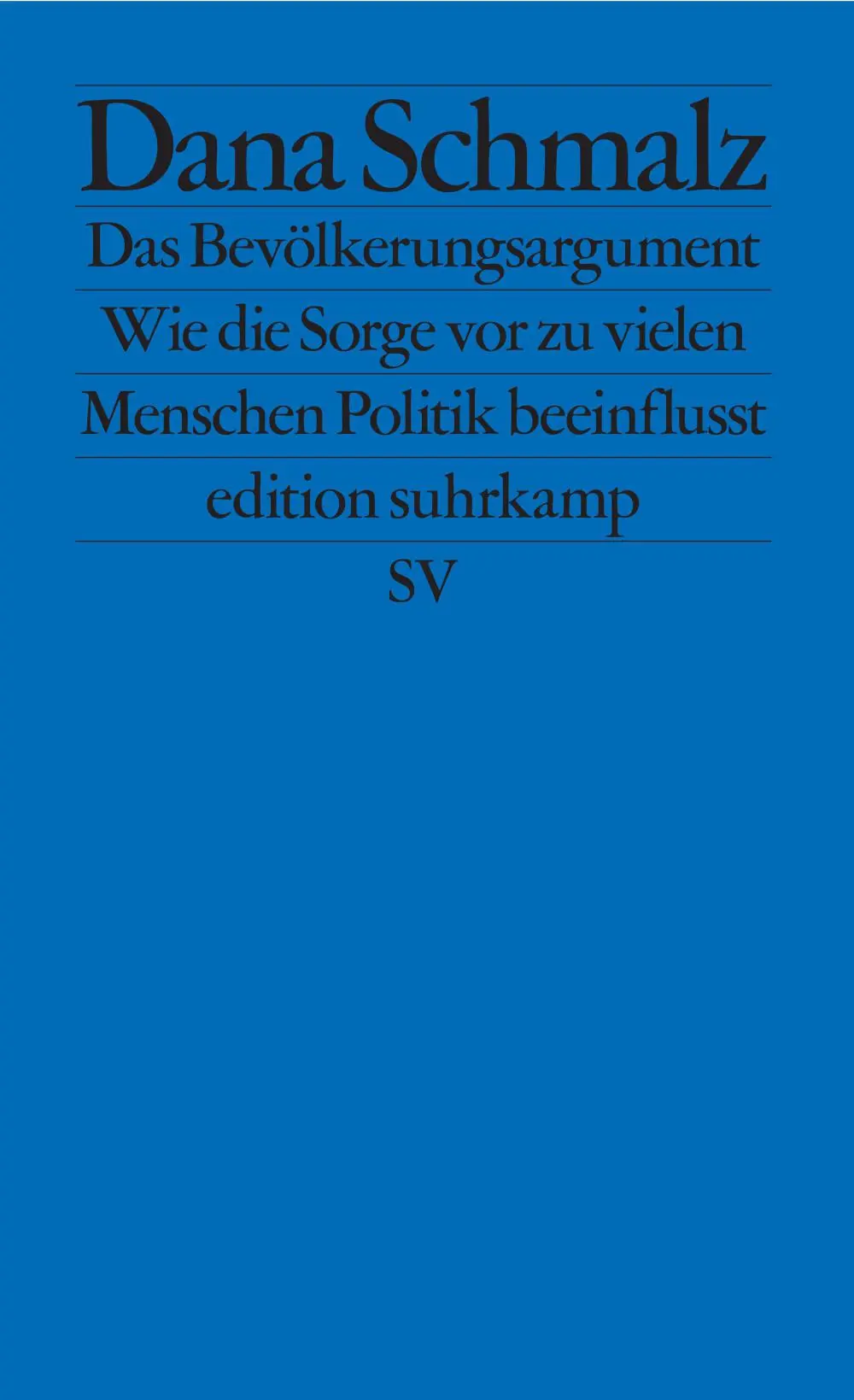
Dana Schmalz:
Das Bevölkerungsargument.
Wie die Sorge vor zu vielen Menschen Politik beeinflusst.
Suhrkamp,
Berlin 2025;
184 S., 18,00 €
Gemessen an der Bevölkerungszahl ist inzwischen Afrika der am schnellsten wachsende Erdteil. Derzeit leben dort rund 1,5 Milliarden und damit 17,5 Prozent aller Menschen weltweit, im Jahr 2050 werden es bereits 25 Prozent sein. Mit Hinweisen auf die Zuwanderung nach Europa und auf den Klimawandel wird vor dieser Entwicklung gewarnt - und dabei vergessen, dass die afrikanischen Fluchtbewegungen überwiegend im eigenen Kontinent stattfinden und für die Erderwärmung vorrangig die Emissionen der Industriestaaten verantwortlich sind.
Der exponentielle Trend bei der Weltbevölkerung nach oben ist jedoch gestoppt. Dazu beigetragen haben vor allem Maßnahmen in den beiden einwohnerstärksten Ländern weltweit, in denen zusammen alleine drei Milliarden Menschen und damit mehr als ein Drittel der Bevölkerung weltweit leben: China propagierte über Jahrzehnte die sogenannte "Ein-Kind-Politik", die mittlerweile etwas weniger rigide praktiziert wird. Und in Indien führte eine breite Aufklärung über Verhütungsmittel und der wachsende Wohlstand zu einer Umkehrung des demografischen Trends.
Weitere Buchrezensionen

Wie tickt der voraussichtlich nächste Bundeskanzler? Die Journalisten Volker Resing und Sara Sievert zeichnen den Weg des Christdemokraten Friedrich Merz nach.

Politik bleibt eine Männerdomäne - trotz über 100 Jahren Frauenwahlrecht. Ein neues Buch zeigt, warum gleiche politische Teilhabe noch immer auf sich warten lässt.

Joseph Croitoru beschreibt die ideologischen und organisatorischen Entwicklungen der Hisbollah seit ihrer Gründung 1982 im Libanon - bis zum Sturz des Assad-Regimes.