Rolle des Bundespräsidenten : Der Notnagel
Bei der Wahl des Bundeskanzlers kommt dem Staatsoberhaupt eine entscheidende Rolle zu. Vor allem wenn Koalitionsverhandlungen scheitern.
Zumindest an einem Punkt waren sich die Kanzlerkandidaten von SPD und Union am Wahlabend einig: Bis spätestens Weihnachten sollen nach dem Willen sowohl von Olaf Scholz (SPD) als auch Armin Laschet (CDU) Koalitionsverhandlungen abgeschlossen, ein neuer Bundeskanzler gewählt und eine neue Regierung gebildet sein. Eine Hängepartie über ein halbes Jahr wie nach der Bundestagswahl 2017 wollen beide verhindern.

So wie hier beim Neujahrsempfang 2020 in Schloss Bellevue könnte es aussehen, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender (links) Olaf Scholz (rechts) zur Wahl und Ernennung als Bundeskanzler gratulieren.
Vieles spricht für eine rot-gelb-grüne "Ampel-Koalition"
Er habe den "Ehrgeiz", dass Angela Merkel (CDU) "nicht noch eine Neujahrsansprache als Bundeskanzlerin halten muss", betonte Scholz in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF am 26. September. Es sei zwar "absurd", ein genaues Datum zu nennen, aber er wolle alles dafür tun, "dass wir vor Weihnachten fertig sind, ein bisschen vorher wäre auch noch gut". Auch Laschet will die Regierungsbildung "auf jeden Fall vor Weihnachten" abschließen. Im kommenden Jahr habe Deutschland den Vorsitz der G7-Staaten, daher müsse die neue Regierung "sehr zeitnah ins Amt kommen", sagte der Christdemokrat.
Auch wenn bislang vieles dafür spricht, dass Scholz als Kanzler einer rot-gelb-grünen "Ampel-Koalition" Merkel ablösen wird, gesichert ist es bislang nicht. Schon gar nicht, ob die Koalitionsverhandlungen, für die sich die Unterhändler von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen am vergangenen Freitag ausgesprochen haben, bis Weihnachten erfolgreich sein werden. Im Gegensatz zu den Landesverfassungen von Bayern, Brandenburg, Baden-Württemberg oder des Saarlandes macht das Grundgesetz zudem keine Vorgaben, bis wann eine neue Regierung nach einer Wahl gebildet werden muss.
Das Vorschlagsrecht liegt beim Staatsoberhaupt
Laut Grundgesetz (Artikel 63 Absatz 1 und 2) wählt der Bundestag den Kanzler auf Vorschlag des Bundespräsidenten. Gewählt ist der Kandidat, wenn er "die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt", sprich: mindestens eine Stimme mehr als die Hälfte aller Abgeordneten erhält. Diese absolute Mehrheit oder auch Kanzlermehrheit liegt im 20. Deutschen Bundestag, der sich am 26. Oktober konstituiert, bei 368 von 735 Stimmen.
In seiner Entscheidung, welchen Kandidaten der Bundespräsident zu welchem Zeitpunkt zur Wahl vorschlägt, ist er verfassungsrechtlich frei. Die Wahl muss auch nicht mit der Konstituierung des Bundestages zusammenfallen, obwohl laut Grundgesetz (Artikel 69) die Amtszeit des Kanzlers und seiner Minister zu diesem Zeitpunkt endet. Auf Ersuchen des Bundespräsidenten müssen Kanzler und Minister ihre Amtsgeschäfte weiterführen, bis ein neuer Kanzler gewählt ist.
„Ich erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen.“
Dies muss nicht der Kandidat der größten Bundestagsfraktion sein, er muss nicht einmal dem Bundestag angehören. Wählbar ist jeder deutsche Staatsbürger, der über das aktive und passive Wahlrecht verfügt. Somit könnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eben auch Armin Laschet oder den CSU-Vorsitzenden Markus Söder zur Wahl vorschlagen. Über letztere Variante ist in den vergangenen zwei Wochen nach der Wahl sogar in der CDU debattiert worden. Laschet selbst stellte schließlich die eigene Kanzlerkandidatur zur Disposition, sollte dadurch eine unionsgeführte Jamaika-Koalition mit Grünen und Liberalen ermöglicht werden.
In der politischen Praxis hat bislang jeder Bundespräsident jenen Kandidaten vorgeschlagen, der sich einer absoluten Mehrheit im Bundestag sicher sein konnte. Und so wurden auch alle acht Bundeskanzler jeweils im ersten Wahlgang gewählt. Dieser Linie ist Frank-Walter Steinmeier auch vor vier Jahren treu geblieben, nachdem die FDP die Sondierungsgespräche mit CDU/CSU und Grünen für eine Koalition acht Wochen nach der Bundestagswahl mit den Worten von Parteichef Christian Linder "Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren" abgebrochen hatte.
Steinmeiers Mahnung
Nach dem Scheitern der Sondierungen nahm Bundespräsident Steinmeier die Parteien öffentlich in die Pflicht: "Ich erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen. Wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält", mahnte er in einer Ansprache.
Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Steinmeier sich vor allem an die SPD richtet, die sich bislang kategorisch einer Wiederauflage der Großen Koalition verweigert und den Gang in die Opposition angekündigt hatte. Die sich anschließenden Gespräche mit dem SPD-Parteivorsitzenden Martin Schulz und anderen Parteichefs von Union, Grünen und FDP erhöhte den öffentlichen Druck auf die Sozialdemokraten, doch in Verhandlungen mit Merkels Union zu gehen. Gleichzeitig machte es das öffentlichkeitswirksame Drängen des Staatsoberhauptes der SPD erst möglich, unter Wahrung des eigenen Gesichts in eine Koalition mit der Union einzuwilligen.
Amt mit herausgehobener Stellung im Fall einer schwierigen Regierungsbildung
Die Situation von 2017 und das Vorgehen Steinmeiers macht deutlich, welch herausgehobene Stellung dem Bundespräsidenten im Fall einer schwierigen Regierungsbildung zukommt. Er fungiert als verfassungsrechtlicher Notnagel. So hatte Steinmeier auch andere Optionen, um die verfahrene Situation aufzulösen: Er hätte Neuwahlen anstreben können oder die Bildung einer sogenannten Minderheitsregierung. Vor allem letzteres wurde in der Presse breit diskutiert und von den erbitterten Gegnern einer großen Koalition in den Reihen der SPD als Alternative gefordert.
Sowohl eine Minderheitsregierung als auch Neuwahlen sind aber ebenfalls nur über den Weg der Kanzlerwahl beziehungsweise deren Scheitern möglich. Die Möglichkeit, Neuwahlen über eine gescheiterte Vertrauensfrage (Artikel 68 Grundgesetz) herbeizuführen, stand nicht zur Verfügung, da Merkel als geschäftsführende Kanzlerin die Vertrauensfrage nicht stellen konnte. Steinmeier hätte zunächst einen ersten Wahlgang im Bundestag einleiten müssen. Die Frage, ob er Merkel oder einen anderen Kandidaten auch gegen deren erklärten Willen zur Wahl hätte vorschlagen können, bietet bereits reichlich Platz für verfassungsrechtliche Interpretationen.
Minderheitsregierung mit drittem Wahlgang möglich
Um Merkel bereits im ersten Wahlgang zur Kanzlerin einer Minderheitsregierung zu wählen, hätte sie ausreichend Stimmen von der Opposition benötigt, um die absolute Mehrheit zu erringen. Eine Tolerierung über Stimmenthaltung hätte nicht ausgereicht. Wäre ihre Wahl hingegen gescheitert, hätte der Bundestag zwei Wochen Zeit gehabt, einen anderen Kandidaten mit absoluter Mehrheit in beliebig vielen Wahlgängen zu küren. In dieser Phase können die Wahlvorschläge laut Geschäftsordnung des Bundestages von einem Viertel der Abgeordneten gemacht werden.
Erst nach Ablauf dieser zweiwöchigen Frist kann in einem dritten und letzten Wahlgang ein Kanzler laut Grundgesetz (Artikel 63 Absatz 4) auch mit der relativen Mehrheit gekürt werden, sprich: er benötigt lediglich mehr Stimmen als jeder andere Kandidat. Bei nur einem Kandidaten gestaltet sich die Formulierung im Grundgesetz, "gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält", schon schwieriger. Verfassungsrechtlich ist nämlich umstritten, ob dies bedeutet, dass der Kandidat in jedem Fall mehr Ja- als Nein-Stimmen benötigt, oder ob ausschließlich die Ja-Stimmen zählen. Zu letzterem Ergebnis kam etwa 2014 der Düsseldorfer Verfassungsrechtler Martin Morlock in einem Rechtsgutachten für das Thüringer Justizministerium.
Kommt die Wahl mit relativer Mehrheit zustande, so kann der Bundespräsident den Gewählten entweder zum Kanzler einer Minderheitsregierung ernennen oder aber den Bundestag aufzulösen. Dann müssen innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen stattfinden.
Auch interessant

Angela Merkel und ihre Minister lenken bis zur Wahl eines neuen Regierungschefs die Geschicke des Landes. Grund ist das Kontinuitätsprinzip.
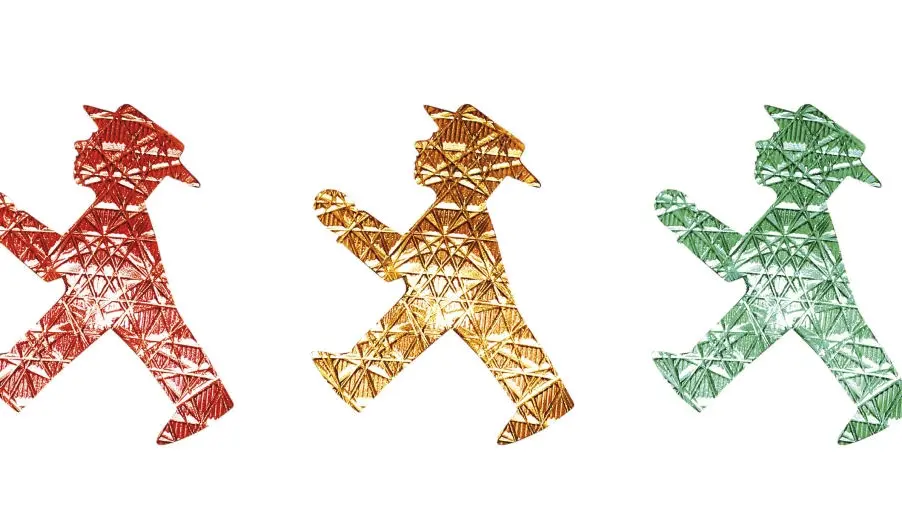
Die Sondierungen für eine Ampel-Koalition sind erfolgreich abgeschlossen. Die Aufnahme formaler Koalitionsgespräche soll in dieser Woche beginnen.
Aktuell gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich die Situation von 2017 wiederholen könnte. Zumal neben der Möglichkeit der Ampel- auch noch eine Jamaika-Koalition als Option im Raum steht. Und an Steinmeiers Ablehnung gegenüber Neuwahlen oder einer Minderheitsregierung hat sich in den vergangenen vier Jahren sicherlich nichts geändert. Dies und die verfassungsrechtlich hohen Hürden sprechen zudem dafür, dass Koalitionsverhandlungen auch ohne seine Intervention erfolgreich beendet werden - vielleicht sogar noch vor Weihnachten.
