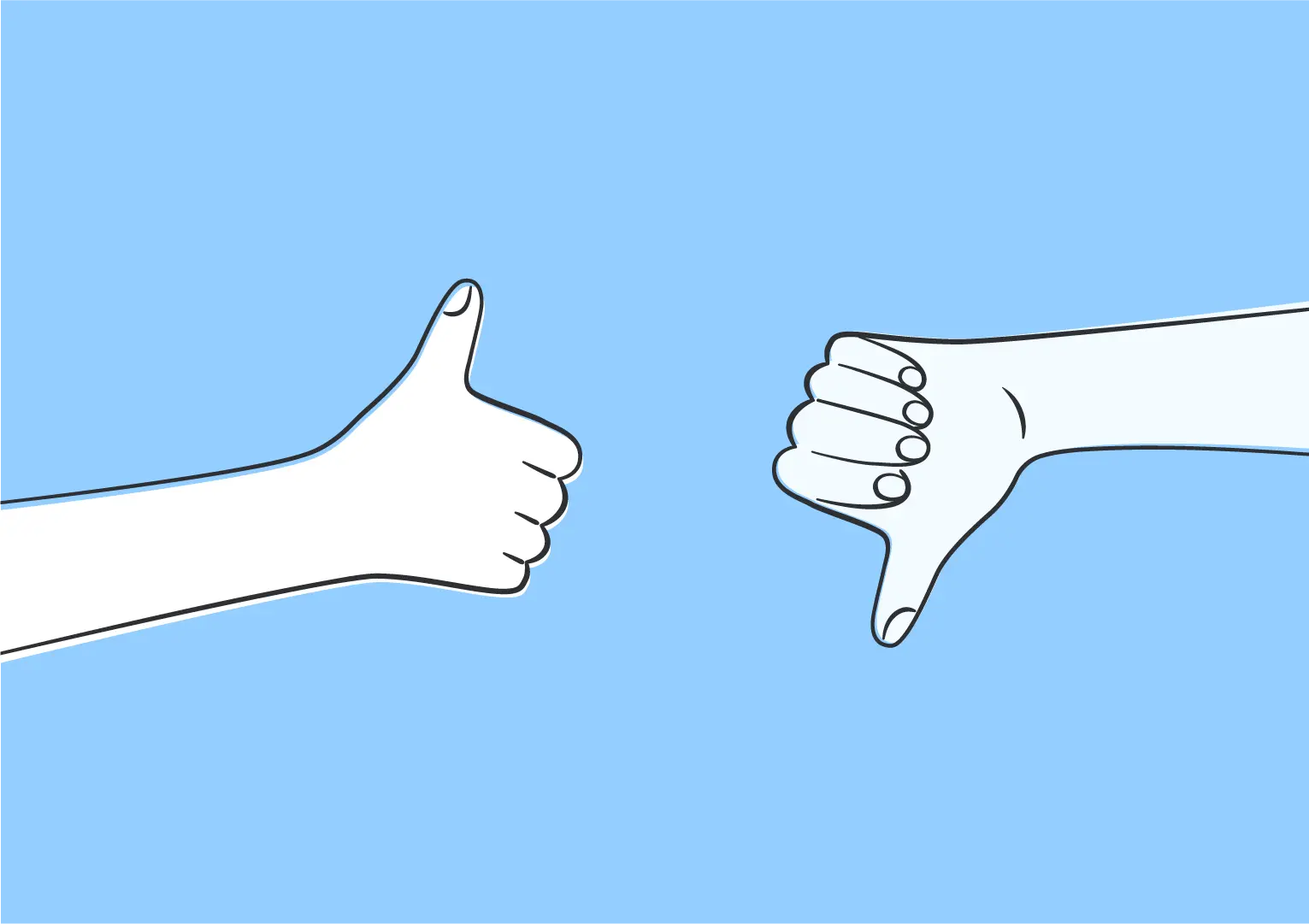Im Sinne der Zeitenwende : Die Zeichen stehen auf Abschreckung
Union und SPD wollen die „Zeitenwende“ weiter ausbuchstabieren: Im Zentrum des Koalitionsvertrags steht die Stärkung der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit.
Für die Außen- und Sicherheitspolitik haben sich die Verhandler gewissermaßen auf eine eigene Präambel verständigt: "Wir wollen uns verteidigen können, um uns nicht verteidigen zu müssen", heißt in Zeile 3961 des Koalitionsvertrags von Union und SPD, der stark im Schatten des russischen Angriffskriegs und damit im Schatten einer lange nicht gekannten Bedrohung der europäischen Sicherheit steht. "Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkrieges müssen Deutschland und Europa in der Lage sein, ihre Sicherheit deutlich umfassender selbst zu gewährleisten."
Ob Zusagen zur weiteren Unterstützung der Ukraine oder Bekenntnis zur Nato und die Willensbekundung, die europäische Säule innerhalb des Bündnisses zu stärken: Eine spektakuläre Kehrtwende ist von Union und SPD in der Außen- und Sicherheitspolitik nicht zu erwarten. Aber merklich umfangreicher und in Teilen auch ambitionierter als bei früheren Koalitionsverträgen fallen die Vorhaben in puncto Bundeswehr und Nato-Verpflichtungen dann doch aus.
Ausgaben für Verteidigung sollen deutlich und stringent steigen
Das zeigt bereits die Finanzierungsgrundlage: Mit der Ausnahme der Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse oberhalb von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts wollen Union und SPD die Basis legen für das weitere Ausbuchstabieren der von der Vorgängerkoalition geerbten "Zeitenwende". Mit anderen Worten: Die Verteidigungsausgaben sollen in dieser Legislaturperiode "deutlich und stringent steigen". Dazu soll es einen mehrjährigen Investitionsplan geben und noch im ersten halben Jahr soll die künftige Bundesregierung ein "Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz für die Bundeswehr" auf den Weg bringen.
Bei Investitionen und Beschaffung für die Truppe sollen bürokratische Hürden gesenkt werden. Prioritäten sollen einerseits bei der Beschaffung von Munition gesetzt werden und andererseits bei der Förderung von Satellitensystemen und Künstlicher Intelligenz, bei Drohnen, Cyber, militärischen IT-Anwendungen sowie bei Hyperschallsystemen. Bei all dem soll der Leitgedanke, die "Einsatzbereitschaft der Streitkräfte kurzfristig, nachdrücklich und nachhaltig erhöhen", nicht zu kurz kommen.
Hier kommt auch das Stichwort Wehrpflicht in Spiel: Die womöglich künftigen Koalitionäre stellen klar, dass sie das auf Freiwilligkeit basierende schwedische Wehrdienstmodell setzen wollen. Als Kriterien sollen Attraktivität dieses Dienstes, seine Sinnhaftigkeit und sein Beitrag zur Aufwuchsfähigkeit der Bundeswehr dienen. Noch in diesem Jahr sollen die Voraussetzungen für eine Wehrerfassung und Wehrüberwachung geschaffen werden.
Union und SPD bekennen sich klar zur Stärkung des transatlantischen Bündnisses und eine faire Lastenteilung, sie wollen auch an der nuklearen Teilhabe innerhalb der Nato als "integraler Baustein der glaubhaften Abschreckung durch das Bündnis" festhalten. Von einer engeren europäischen Zusammenarbeit erhofft sich Union und SPD eine Bündelung der Rüstungsbeschaffung und damit Kosteneinsparungen ("Simplification, Standardization und Scale").
Koalitionäre stellen sich hinter Nato-Perspektive für die Ukraine
Knapper fallen die Formulierungen zur klassischen Außenpolitik im Koalitionsvertrag aus. Die transatlantische Partnerschaft wird als Erfolgsgeschichte beschrieben, an ihr wollen die Koalitionäre "auch unter neuen Bedingungen" festhalten. Anders als dies derzeit von US-Seite artikuliert wird, will sich die neue Bundesregierung weiter hinter die Nato-Perspektive für die Ukraine stellen.
Unschärfer formuliert der Koalitionsvertrag Bedingungen für eine deutsche Beteiligung an Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land nach einem möglichen Waffenstillstand: Hier ist von "materiellen und politischen Sicherheitsgarantien für eine souveräne Ukraine" die Rede.
Mit Blick auf China soll Zusammenarbeit möglich bleiben, "wo dies im deutschen und europäischen Interesse liegt". Bei Handel und Investitionen soll es aber volle Reziprozität geben. Betont wird eine zunehmende "systemische Rivalität": Einseitige Abhängigkeiten sollen abgebaut werden ("De-Risking"). Die Chinapolitik insgesamt soll nach den Vorstellungen von Union und SPD kohärenter und stärker EU-abgestimmt gestaltet werden. Für den Indopazifik unterstreichen die wohl künftigen Koalitionäre die Bedeutung von Partnerschaften mit Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea und die Vertiefung der Beziehungen mit Indien.
UNRWA-Unterstützung unter der Lupe, Revolutionsgarden auf EU-Terrorliste
Im Nahen und Mittleren Osten betont der Koalitionsvertrag insbesondere die Bedeutung Israels und die Solidarität mit Israel nach den Terrorangriffen der Hamas im Jahr 2023. Das Existenzrecht und die Sicherheit Israels blieben Teil der deutschen Staatsräson. Zugleich müsse es um eine grundlegende Verbesserung der Lage im Gaza-Streifen gehen.
Für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern behalte die Perspektive einer zu verhandelnden Zweistaatenlösung ihre Gültigkeit. Die Unterstützung für das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA will die künftige Bundesregierung von umfassenden Reformen abhängig machen.
Für weiterhin dringlich geboten halten es Union und SPD, den Iran in seinen Nuklearambitionen zu begrenzen. Zusammen mit den USA, dem Vereinigten Königreich und Frankreich solle Deutschland darauf drängen, das iranische Nuklear- und das ballistische Raketenprogramm zu beenden. Die iranischen Revolutionsgarden sollen zudem auf die EU-Terrorliste gelistet werden.
Künftige Koalitionspartner üben Kritik am Konsensprinzip auf EU-Ebene
Auf EU-Ebene stechen vor allem drei Vorhaben der möglichen neuen Koalition heraus. Vertragsverletzungsverfahren gegen einzelne EU-Mitglieder sollen deutlich schärfer als bisher ausfallen können. Auch dürfe das Konsensprinzip im Europäischen Rat nicht zur "Entscheidungsbremse" werden. "Dies gilt grundsätzlich auch für die verbliebenen Entscheidungen mit Einstimmigkeit im Rat." Ländern wie Ungarn, die etwa in Bezug auf EU-Sanktionen gegen Russland aus der Reihe tanzen, dürften mit weniger Nachgiebigkeit rechnen können, sollte sich die Bundesregierung mit ihren Vorstellungen in Brüssel durchsetzen. Beitrittskandidaten der EU wie die Ukraine oder etwa die Länder des Westbalkans sollen nach Willen von Union und SPD weiterhin nicht die Tür vor der Nase zugeschlagen werden, allerdings müsse die Aufnahmefähigkeit durch institutionelle Reformen gestärkt werden.
Als Prioritäten für die langjährige Haushaltsaufstellung der EU sieht der Koalitionsvertrag die Stärkung der europäischen Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit sowie die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU. Betont wird zudem der Plan einer Wiederaufwertung der regelmäßigen Abstimmung auf der Achse Paris, Berlin, Warschau ("Weimarer Dreieck") und die fallweise Öffnung dieses Formats für weitere Partner ("Weimar plus").
Mehr zum Koalitionsvertrag

Neuer Name für das Bürgergeld und stabiles Rentenniveau bis 2031– das haben sich Union und SPD laut Koalitionsvertrag in der Arbeits- und Sozialpolitik vorgenommen.

Im Koalitionsvertrag setzen Union und SPD auf Steueranreize für mehr Investitionen und weniger Bürokratie, um die Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs zu bringen.
Koalition will mehr privates Kapital für Entwicklungsziele mobilisieren
Für die Entwicklungszusammenarbeit sehen Union und SPD wirtschaftliche Zusammenarbeit und Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen, die Fluchtursachenbekämpfung sowie die Zusammenarbeit im Energiesektor als strategische Ziele. Betont wird in diesen Zusammenhang die "Kooperationsbereitschaft der Partnerländer bei den Bemühungen, die irreguläre Migration nach Europa zu begrenzen und eigene Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zurückzunehmen".
Insgesamt stellt sich die wahrscheinlich künftige Koalition auf weniger öffentliche Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit ein: "Aufgrund der Notwendigkeit, den Haushalt zu konsolidieren, muss eine angemessene Absenkung der ODA-Quote erfolgen." Im Gegenzug soll noch mehr privates Kapital für Entwicklungsziele mobilisiert werden. Für humanitäre Hilfe und Krisenprävention versprechen die Koalitionäre hingegen eine "auskömmliche Finanzierung". Geprüft werden soll, inwieweit Deutschland nach dem Ausfall anderer Geber in wichtigen Bereichen einspringen könne.
Der Nationale Sicherheitsrat soll kommen
Neu bewertet werden dürfte in der neuen Wahlperiode das Zusammenspiel von Auswärtigem Amt und Kanzleramt: Erstmals seit bald 60 Jahren stellt die Union den Außenminister oder die Außenministerin im Kabinett, der oder die wiederum wie der wahrscheinliche künftige Kanzler Friedrich Merz (CDU) Mitglied der Union sein dürfte.
In früheren Koalitionen der letzten Jahrzehnte war das Auswärtige Amt stets an den kleineren Koalitionspartner gegangen und fungierte häufig gewissermaßen als Amt des Vizekanzlers. In diesem Lichte eines Einvernehmens zwischen beiden Häusern ist womöglich die Verständigung von Union und SPD auf die Weiterentwicklung des Bundessicherheitsrat zu einem Nationalen Sicherheitsrat im Bundeskanzleramt zu interpretieren. Das Gremium soll die "Sicherheitspolitik koordinieren, Strategieentwicklung und strategische Vorausschau leisten, eine gemeinsame Lagebewertung vornehmen und somit das Gremium der gemeinsamen politischen Willensbildung sein".
Die Schaffung eines Nationalen Sicherheitsrates hatte sich ursprünglich auch die Ampel-Vorgängerregierung vorgenommen, das scheiterte aber unter anderem an Kompetenzstreitigkeiten zwischen Auswärtigem Amt und Kanzleramt und den beteiligten Koalitionären.