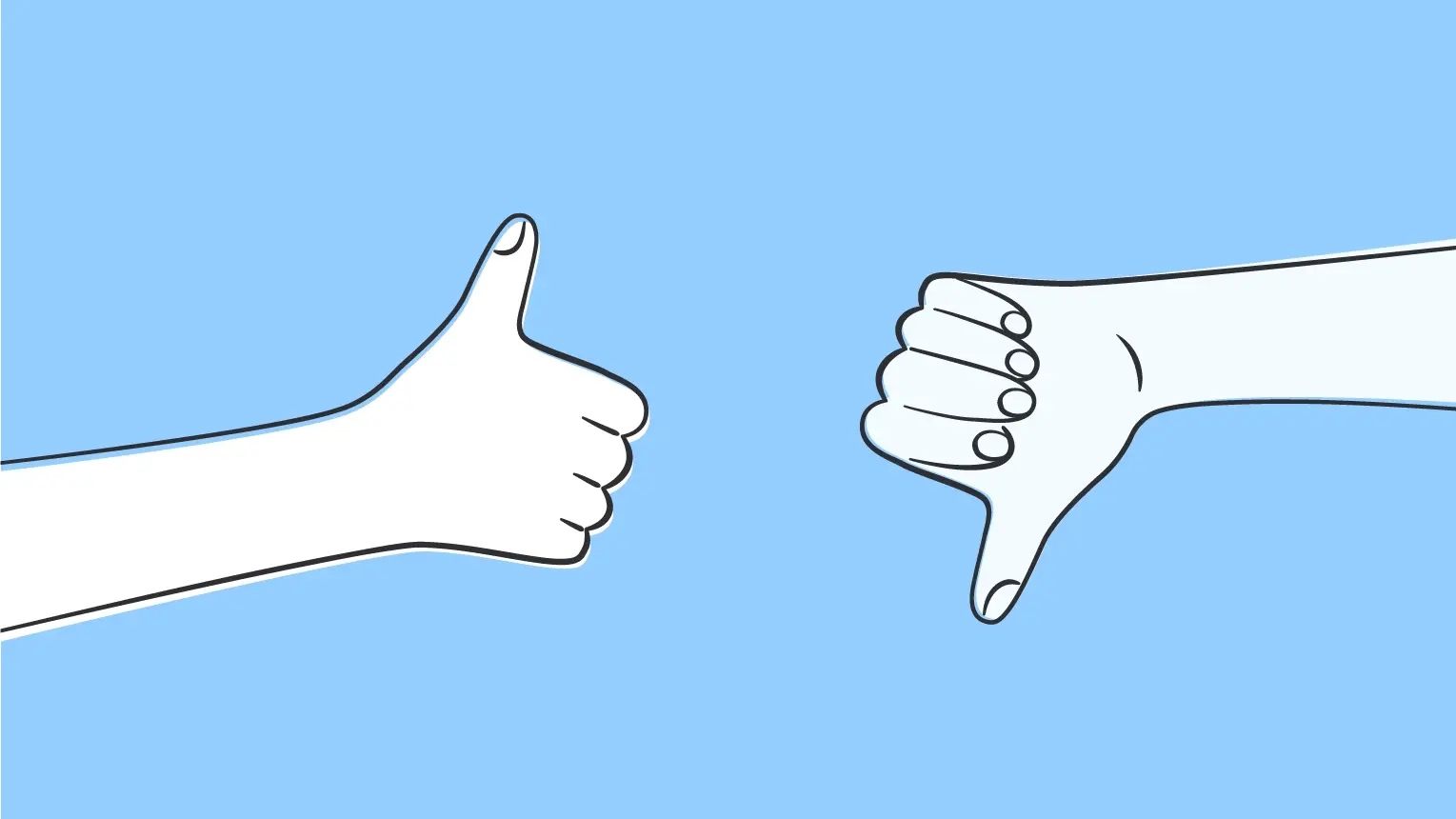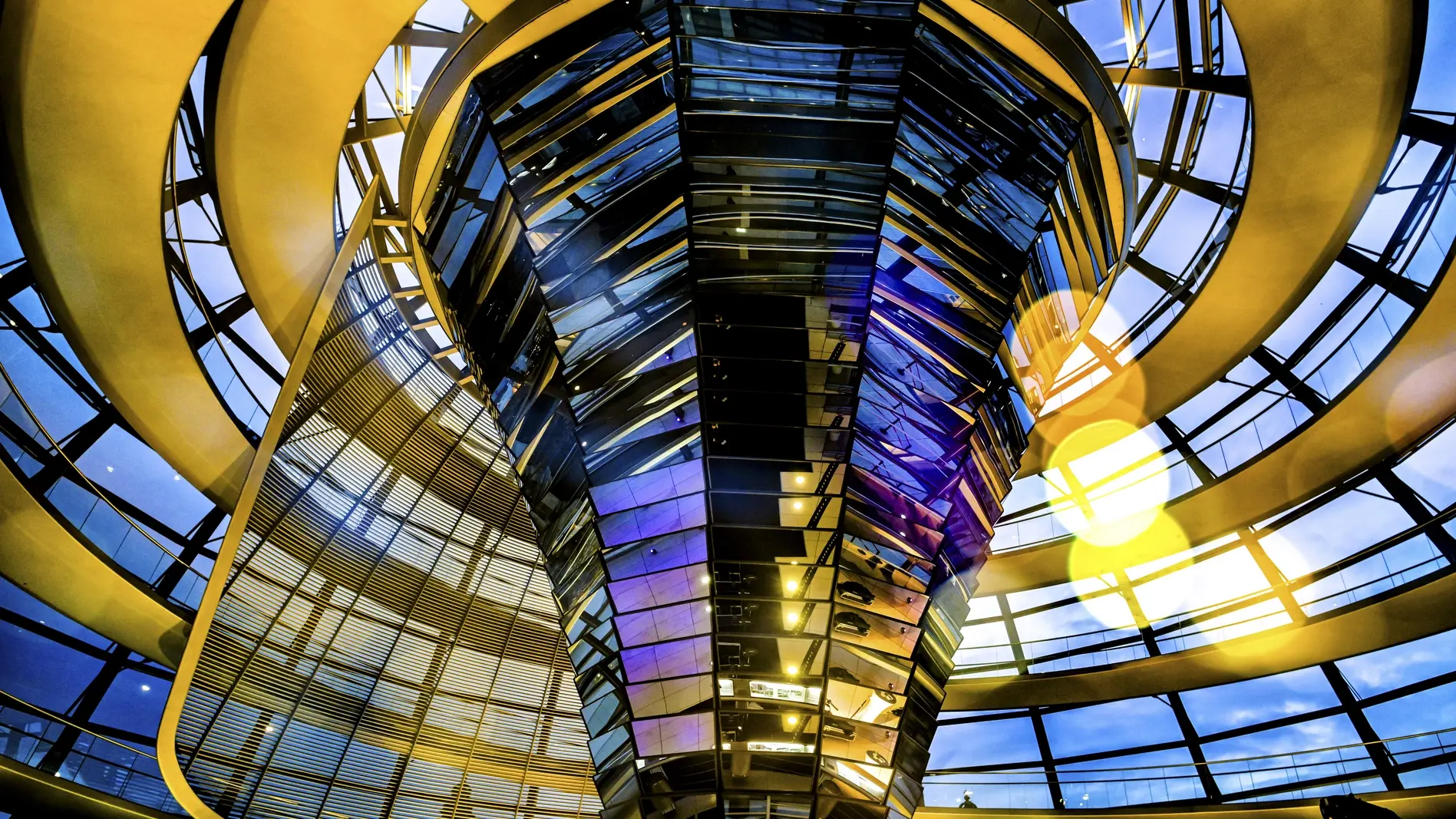
Innenpolitischer Rückblick : Was bei Migration, Sozialem, Bildung und Co. passiert ist
Bürgergeld eingeführt, BAföG erhöht, Krankenhaussektor und Filmförderung reformiert, aber keine Kindergrundsicherung verabschiedet - und viel Streit über Migration.
Inhalt
Als "Fortschrittskoalition" sind SPD, Grüne und FDP im Dezember 2021 angetreten. Knapp drei Jahre später zerbrach das Mitte-Links-Bündnis, die Wahlperiode endet mit den Neuwahlen am 23. Februar vorzeitig. Das Parlament befasste sich in dieser Zeit unter anderem mit der Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine - Stichwort: “Zeitenwende”. Auch andere Themen spielten eine gewichtige Rolle. Nicht immer gelang es der Koalition dabei, ihre Ankündigungen auch umzusetzen.
Inneres: Migrationspolitik unter dem Druck der Flüchtlingszahlen
In ihrem Koalitionsvertrag kündigte die Ampel einen "Neuanfang" in der Migrationspolitik an mit Erleichterungen etwa beim Bleiberecht und bei der Einbürgerung. Bald darauf begann Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, aus der mehr als 1,1 Millionen Flüchtlinge in Deutschland Schutz fanden; daneben stieg die Zahl der Asylerstanträge von knapp 135.000 in 2021 auf gut 329.000 im Jahr 2023. Auch wenn die Zahl 2024 auf knapp 230.000 sank, setzte dies die Ampel massiv unter Druck, verstärkt noch vom Eindruck tödlicher Anschläge von Migranten wie zuletzt in Magdeburg und Aschaffenburg.
Dennoch setzte sie eine Reihe ihrer Vorhaben um, so das 2022 beschlossene "Chancen-Aufenthaltsrecht", das Geduldeten ein Bleiberecht ermöglichen sollte, oder das 2023 verabschiedete Fachkräfteeinwanderungsgesetz sowie die Anfang 2024 beschlossene Reform des Staatsangehörigkeitsrechts mit einer generellen Hinnahme von Mehrstaatigkeit und weiteren Erleichterungen der Einbürgerung.
Daneben ergriff die Koalition restriktive Maßnahmen: Der Einstufung von Georgien und Moldawien als sichere Herkunftsländer im November 2023 folgte Anfang 2024 das "Rückführungsverbesserungsgesetz" das für mehr Abschiebungen sorgen sollte. Deren Zahl lag 2024 bei rund 20.100 nach gut 16.400 im Vorjahr und knapp 13.000 im Jahr 2022. Weitere Verschärfungen brachte im Oktober 2024 das "Sicherheitspaket", etwa den Ausschluss von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für bestimmte Fälle der Sekundärmigration. Schrittweise ausgeweitet wurden die Grenzkontrollen, die es seit September 2024 an allen deutschen Landgrenzen gibt.
Den Mitte 2023 gefundenen Kompromiss der EU-Innenminister für eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems zählt die Koalition zu den großen Erfolgen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). 2024 stimmte das Europäische Parlament der Verschärfung des EU-Asylrechts zu, mit der Flüchtlinge bei unbegründeten Asylanträgen direkt von der Außengrenze abgeschoben werden sollen.
Auf internationaler Ebene setzte die Ampel zudem auf bilaterale "Migrationsabkommen", mit denen dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und irreguläre Migration begrenzt werden sollen. Solche Abkommen oder Verhandlungen darüber gibt es mittlerweile etwa mit Indien, Georgien, Moldau, Usbekistan, Kirgisistan, Kenia, Kolumbien, Marokko, Ghana und den Philippinen.
Soziales: Mindestlohn, Bürgergeld und Rentenpaket
Sozialpolitisch konnte zumindest die SPD ein Jahr nach dem Start sagen: Wir arbeiten unsere Wahlversprechen ab: Im Oktober 2022 wurde der gesetzliche Mindestlohn außerplanmäßig von 10,45 Euro auf zwölf Euro je Stunde angehoben. Ein paar Wochen später wurde die, aus Sicht der SPD, "größte sozialpolitische Reform seit Jahrzehnten" verabschiedet und das Bürgergeld eingeführt, das den Vorgänger Hartz IV ablöste. Doch seitdem tobt eine zuweilen scharf geführte Debatte über das Bürgergeld mit seiner stärkeren Fokussierung auf Weiterbildung und Qualifizierung, großzügigeren Regeln bei der Vermögenanrechnung und milderen Sanktionen. Zwar verschärfte die Ampel unter diesem Druck einige Regeln wieder. Doch die Union hat angekündigt, das Bürgergeld wieder abschaffen zu wollen.
Um ein anderes sozialpolitisches Prestigeprojekt der SPD wurde lange gerungen und im Frühherbst 2024 bewegte es sich eigentlich schon auf die Zielgerade zu: das Rentenpaket II. Damit sollte die 2018 eingeführte Haltelinie für das Rentenniveau von 48 Prozent verlängert werden. Die Rentenbeiträge sollten dafür mittelfristig auf 22,3 Prozent steigen. Um den Beitragsanstieg abzumildern, war der Einstieg in eine teilweise aktienbasierte Finanzierung (Generationenkapital) geplant. Das vorzeitige Ampel-Aus verhinderte nicht nur die Verabschiedung des Rentenpakets II, sondern auch das lange angekündigte und immerhin schon vom Kabinett gebilligte Tariftreuegesetz.
Familie: Prestigeprojekt Kindergrundsicherung ist gescheitert
Mit der Kindergrundsicherung von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sollten Kinder aus der Armut geholt werden, indem familienpolitische Leistungen gebündelt, besser zugänglich gemacht und auch erhöht werden sollten. Finanzminister Christian Lindner (FDP) machte schnell klar, dass das Familienministerium nicht mit dem gewünschten zweistelligen Milliardenbetrag rechnen könne. Stattdessen hatten sich die Parteien auf Leistungserhöhungen innerhalb der bisherigen Strukturen geeinigt. Nach der Anhörung im Familienausschuss verschwand die Kindergrundsicherung in der Schublade. Das gleiche Schicksal suchte das Demokratiefördergesetz heim, wie die Kindergrundsicherung ein weiteres grünes Vorzeigeprojekt.
Mit dem Selbstbestimmungsgesetz (gilt seit 1. November 2024) dagegen konnten die Grünen eines ihrer zentralen Versprechen umsetzen: Es löste das Transsexuellengesetz ab und ermöglicht seitdem Transpersonen, ihren Geschlechtseintrag und Vornamen in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern zu lassen.
Gesundheit: Manche Reform ist auf der Strecke geblieben
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in seiner Amtszeit ein Feuerwerk an Reformen und Reformankündigungen gezündet. Die Liste der beschlossenen Gesetze und Verordnungen ist an sich schon beachtlich, die Liste an nicht mehr beschlossenen Reformvorhaben allerdings auch. Während zu Beginn der Legislatur die Corona-Pandemie in der Gesetzgebung bestimmend war, verlagerte sich der Schwerpunkt später auf Krankenhäuser, Pflege, Arzneimittel, Digitalisierung, Forschung sowie Finanzierungsfragen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
Mit dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) ist zuletzt eine große Reform verabschiedet worden, die nach langem Streit auch im Bundesrat die nötige Mehrheit fand. Das Ziel ist eine Spezialisierung der Krankenhäuser und damit auch eine bessere Qualität der Versorgung. In einem ersten Schritt war zuvor schon der Krankenhaus-Atlas an den Start gegangen. Auf einer neuen Homepage können sich Versicherte und Patienten über die Behandlungsangebote von Krankenhäusern informieren.
Auch die Digitalisierung des Gesundheitssystems ist einen Schritt nach vorne gekommen. So beschloss der Bundestag mit dem Digitalgesetz ab 2025 die verbindliche Einrichtung der elektronischen Patientenakte (ePA) für alle Versicherten, die dem nicht widersprechen, sowie das elektronische Rezept (E-Rezept) als verbindlichen Standard.
Zahlreiche Gesetzesvorhaben sind zuletzt jedoch liegen geblieben, was von Fachpolitikern und Fachverbänden jeweils sehr bedauert wurde. Dazu gehören das Pflegekompetenzgesetz und das Pflegefachassistenzeinführungsgesetz, die Neuregelung der Lebendorganspende, das Gesundes-Herz-Gesetz, der Gesetzentwurf zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit und die geplante Reform der Notfallversorgung. Auch ein Vorschlag zur langfristigen Finanzierung der Kranken- und Pflegeversicherung wurde erwartet. Mit der alten Ampel-Mehrheit kurzfristig noch umgesetzt wurde die Entbudgetierung der Hausärzte mit dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG).
Bildung: Startchancenprogramm für Brennpunktschulen verabschiedet
Mit dem Startchancen-Programm hat die Ampel-Koalition nach eigenen Angaben das größte und langfristigste Bildungsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik auf den Weg gebracht. Nach zähen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern konnte das Programm Anfang 2024 beschlossen werden. Ab dem Schuljahr 2024 investieren Bund und Länder zu gleichen Teilen über einen Zeitraum von zehn Jahren insgesamt 20 Milliarden Euro in rund 4.000 Schulen, die einen besonders hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler aufweisen.
Ziel des Programms ist es, das deutsche Bildungssystem leistungsfähiger und gerechter zu gestalten. Im Mittelpunkt stehen dabei die Förderung der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen sowie der Ausbau des Unterstützungssystems für schulische Bildung.
Finanziell besser gestellt werden sollen künftig auch Studierende. Nach monatelangem Ringen einigte sich die Ampel-Koalition auf eine Erhöhung des BAföG um rund fünf Prozent. Zusätzlich wurde eine Anhebung der Wohnkostenpauschale sowie des Elternfreibetrags beschlossen. Neu eingeführt wurde außerdem eine sogenannte Studienstarthilfe: Bedürftige Studienanfängerinnen und -anfänger erhalten einmalig 1.000 Euro zu Beginn ihres Studiums.
Recht: Bürokratie abgebaut, Suizidbeihilfe bleibt ungeregelt
Das Feld der Rechtspolitik ist ein weites Feld, entsprechend umfangreich war die Agenda der gescheiterten Ampel-Koalition. So ging es unter anderem um den Bürokratieabbau. Mit dem Ende September 2024 verabschiedeten Bürokratieentlastungsgesetz IV soll die Wirtschaft um knapp eine Milliarde Euro Erfüllungsaufwand pro Jahr entlastet werden. Aus Sicht der Opposition griffen die Maßnahme zum Bürokratieabbau, etwa die Absenkung von Formerfordernissen, allerdings viel zu kurz.
Das Haus von Ex-Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erwies sich als produktiv und brachte viele kleinteilige Entwürfe auf den Weg, um etwa die Digitalisierung im Justizwesen voranzubringen. Mit Blick auf die Strafrechtspolitik blieb die Ampel hinter ihren eigenen Ansprüchen zurück. Zwar schaffte die Koalition im Juni 2022 das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ab, die geplante Entrümpelung des Strafgesetzbuches fiel aber ebenso aus wie die Einführung der Ermittlungsinstrumentes "Quick Freeze".
Rein auf parlamentarische Initiative ging die erneute Debatte über Regelungen zur Suizidbeihilfe zurück. Allerdings fand keiner der vorgelegten Gesetzentwürfe der Parlamentariergruppen eine Mehrheit. Die Suizidbeihilfe bleibt damit ungeregelt.
Ebenfalls auf eine parlamentarische Initiative - mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Justizreform - ging die fraktionsübergreifende Initiative zum Schutz des Bundesverfassungsgerichtes zurück, die im Dezember 2024 vom Bundestag verabschiedet worden ist. Künftig sind wichtige Strukturmerkmale des Gerichtes im Grundgesetz verankert - und können folglich nicht so einfach geändert werden.
Kultur: Die große Reform der Filmförderung ist gescheitert
Erst auf den letzten Metern der Legislatur haben doch noch zwei zentrale kulturpolitische Vorhaben der gescheiterten Ampelkoalition den Bundestag passiert. Ende Januar verabschiedete er die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), die den 25 angeschlossenen Museen, Bibliotheken und Instituten mehr finanzielle Flexibilität einräumen und die Führungsstrukturen der SPK effizienter machen soll.
Mehr zur Filmförderung

Der Bundestag verabschiedet zwar ein neues Filmförderungsgesetz. Aber die geplante große Reform der Filmförderung des Bundes ist gescheitert.
Im Dezember 2024 verabschiedete der Bundestag zudem das neue Filmförderungsgesetz, das der Filmförderungsanstalt neue Kompetenzen zuweist und die Filmförderung durch ein Referenzmodell weitestgehend automatisiert. Die von Staatsministerin Claudia Roth (Grüne) geplante große Reform mit einem Steueranreizmodell für Filmproduktionen in Deutschland sowie eine Investitionsverpflichtung für Streamingdienste hingegen ist gescheitert.
Bundestag: Erbitterter Streit über das Wahlrecht
Erbittert gestritten haben die Abgeordneten über das Wahlrecht. Nachdem in einer eigens dafür eingesetzten Kommission kein Konsens gefunden werden konnte, setzte die Ampel-Koalition ihre Wahlrechtsreform gegen den Widerstand von Union und Linken durch. Die Zahl der Abgeordneten wird damit auf 630 begrenzt, dafür könnten künftig einige Wahlkreise „verwaist“ sein. Die von der Ampel-Koalition ebenfalls geplante Abschaffung der Grundmandatsklausel scheiterte vor dem Bundesverfassungsgericht.
Über die Geschäftsordnung gab es ebenfalls Debatten. Zu Beginn der Wahlperiode setzte die Ampel-Koalition unter anderem durch, dass die Ausschüsse öfter öffentlich tagen können. Eine Verschärfung des Ordnungsrechts im Parlament, die seit Sommer 2024 diskutiert wird, scheint hingegen nicht mehr verabschiedet zu werden.
Die Abgeordneten mussten sich nach der Auflösung der Fraktion Die Linke zudem mit den Rechten der Gruppen Linke und BSW befassen. Ursprünglich sahen die neuen Regeln unter anderem vor, die Zahl der Kleinen Anfragen zu begrenzen. Dagegen klagen die Linken in Karlsruhe. Diese Regel wird aktuell nicht angewandt.
Änderungen gab es auch im Petitionsrecht. Der Petitionsausschuss senkte Mitte 2024 unter anderem das Quorum ab, ab dem eine Petition öffentlich beraten ist.